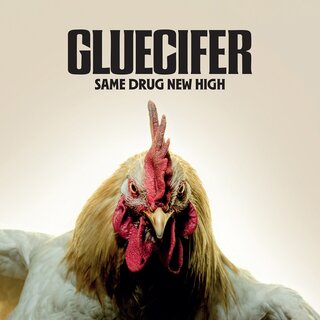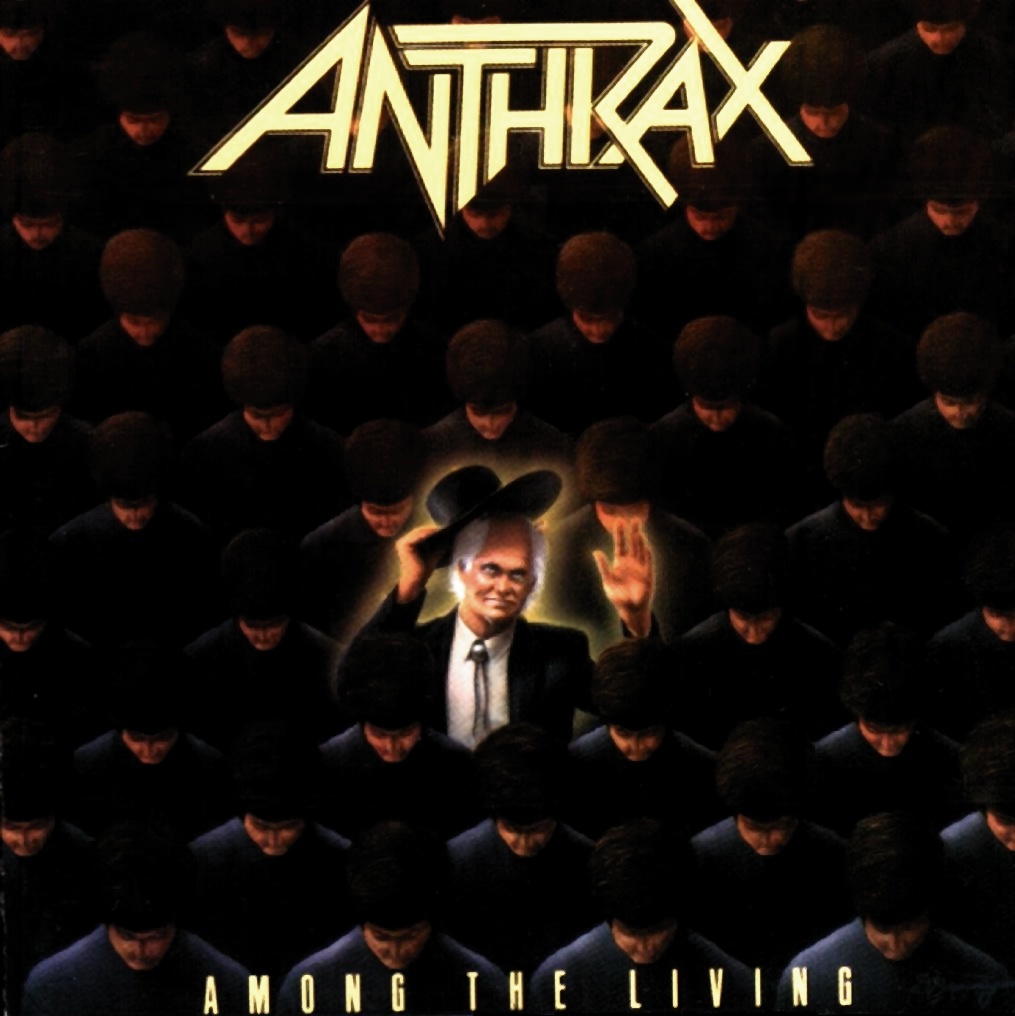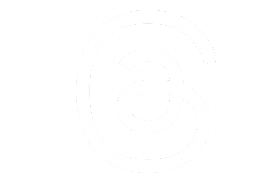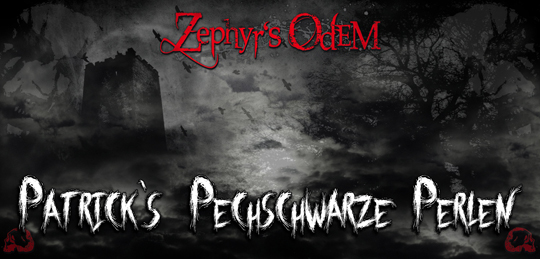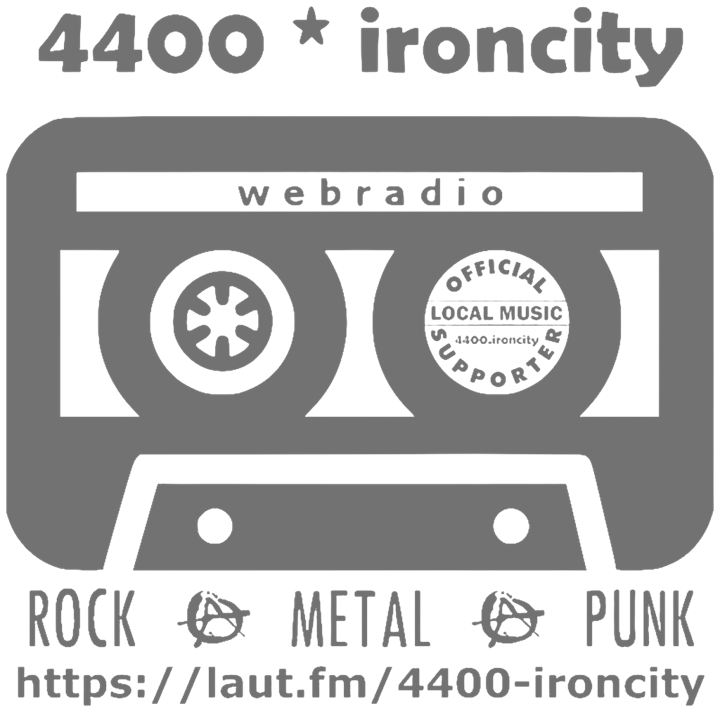Aktuelle Meldungen
Live-Report: Rock Harz 2025 TAG 1
Mittwoch, 02.07.2025 - Hitzewelle de luxe!

Endlich wieder Ballenstedt. Endlich wieder Rock Harz. Und endlich mal wieder das große Zelt aufbauen – bei 40 Grad im Schatten, die es natürlich nicht gab. Wer dachte, er schwitzt nicht, schwitzte trotzdem. Vier Liter Wasser später, das erste Mal pinkeln um 20 Uhr – Verdunstung ist real. Die Natur kennt keine Gnade, nur die Sonne. Und die hat sich dieses Jahr zur Festivalleitung erklärt.
Während ich noch damit beschäftigt war, meine inneren Organe mit Elektrolyten zu versöhnen, war unser DÖ längst vor Ort – samt geölter Campingflagge und bewaffnet mit Kollege Schnittker von Powermetal.de im Kampf um den besten Campground. Es wurde taktiert, getrickst und gesichert, bis der heilige Quadratmeter Heimat stand. Mission erfüllt.
Nach sage und schreibe 13 Jahren mal wieder in Ballenstedt – und ganz ehrlich: Es hat sich kaum etwas verändert. Aber warum auch? Never change a running System, sagte schon meine Festivalhose von 2012, die noch immer passt – zumindest optisch.
Die Akkreditierung? Dauerte fünf Minuten. Fünf Minuten! Festivalrekord. Einmal kurz “Hallo”, zack, Bändchen dran, ab ging die Luzie. Und die Luzie war nicht allein: alle hatten Bock, das Infield war rappelvoll, so wie so manche Leber auch. Nur einer hatte offensichtlich zu viel: der Feuerball am Himmel. Unerbittlich brutzelte er Köpfe, Schultern, Hirnzellen. Da half nur eins – und das war keine warme Cola: Die bereits im Vorfeld errichtete Schneekanone wurde zur Wallfahrtsstätte, zur Oase, zur frostigen Erlösung in einer Welt aus Grillfleisch und Sonnencremefett. Wer nicht patschnass war, war entweder tot oder Pavillondieb.
Willkommen zum Rock Harz 2025 – heiß, hart und herrlich wie eh und je.
Schon beim Betreten des Geländes lag etwas in der Luft – und dann begann es auch ohne Umschweife: Es war Fuckers‑Time! Als Opener fantastisch gewählt – mit voller Wucht stiegen EXCREMENTORY GRINDFUCKERS in ihr Set ein, und das Stadion erbebte. Der Song Nein, kein Grindcore donnerte durch die Lautsprecher, eine überraschende, aber geniale Wahl, die das Publikum sofort in ihren Bann zog – ein typisches Grind‑Spaß‑Monster!
Die hannoversche Fun‑Metal‑Grindcore-Band mischte damals deutsche Schlagermelodien mit gnadenlosem Grindcore – dieser Mix war auch hier live unverkennbar. Rob, Christus & Co. lieferten sich ein Power‑Riff‑Feuerwerk.
Kaum angeheizt, gab es auch schon die ersten Pits, die im Takt des aggressiven Blastbeats ihre Runden drehten – ein Mordsspaß für Zuschauer und Band gleichermaßen. Die Energie war durchgehend am Anschlag, die Griffe der Gitarren griffen ins Mark, und Rob hüpfte zwischen den Fans herum wie ein Derwisch.
Im Mittelteil wurde es hymnisch mit dem Dauerbrenner Halb & Halb.– und live war klar, warum. Die Stimme der Crowd wurde zum fünften Bandmitglied, als jeder Refrain synchron mitgegrölt wurde. Gänsehaut pur. Natürlich fehlte das unverzichtbare Finale nicht: zwischen donnernden Gitarren und fetten Breakdowns gaben EXCREMENTORY GRINDFUCKERS Vollgas, bis der letzte Ton verklingt. Und dann – mit aller Macht – endete das Konzert. Leider!
Großartige Band und Spaß bis zum Anschlag! Die Show war ein wilder Ritt, bei dem Humor und Härte perfekt verschmolzen – vom Flummi das Reh‑Knaller bis zum Crowd‑Kracher Halb & Halb. Ein Abend, der bewies: Wenn EXCREMENTORY GRINDFUCKERS loslegen, heißt es: Pit an, Party an!

Schon beim ersten Blick über den Festivalplatz wird klar: TYR ist lange nicht mehr live gesehen worden – und die Wiedersehensfreude ist riesig. Die Sonne knallt, das Bier fließt, und endlich nimmt die Band um Heri Joensen – Frontmann, Gitarrist und Personalunion in Sachen Wikingercharisma – ihren Platz ein.
Der Auftakt mit By the Sword in My Hand eröffnet das Set klassisch und energiegeladen. Sofort zeigt sich: die Band ist engagiert, die Riffs sitzen, doch der Sound wirkt stellenweise etwas verwaschen – als hätte jemand Heu ins Verstärkerkabel gestreut. Dennoch: die gute Bewegung im Publikum ist nicht zu übersehen, es wogt und hüpft in Wellen, als würden Segel über raues Meer brechen.
Weiter geht’s mit Blood of Heroes und Axes – letzteres stammt vom neuen Album Battle Ballads (2024). Frischer Stoff, der live gut zündet. Die Crowd reagiert begeistert, lässt sich von den kraftvollen Melodien mitreißen, aber die doch etwas neblig-abgemischten Gitarren machen’s Fans schwer, jede Nuance zu genießen.
Mit Mare of My Night geht’s in ruhigere Gewässer – progressive Folk-Anteile kommen zum Vorschein, und für einen Moment kehrt Ruhe ein. Doch kaum wechselt die Band zu Hammered, verpufft die Stille: ein treibender Rhythmus, der erneut Bewegung ins Publikum bringt.
Mit Sinklars vísa geht’s dann in altes Fahrwasser: eine traditionelle färöische Ballade in metallischem Gewand – live kommt diese Folk-Nummer besonders gut an, Gänsehaut pur. Der historische Touch vermag die Zuhörer tief zu berühren, ein Highlight der Setlist. Zum krönenden Finale reitet TYR mit Hold the Heathen Hammer High noch ein letztes Mal in den Wikingerhimmel – mitschunkelnd, mitsingend und komplett in Feierlaune verabschiedet sich die Band von der Bühne. Publikum: absolut vibrierend und in Hochform.
TYR liefern ein kraftvolles Set ab, haben lange gefehlt und machen mit viel Spielfreude und Bewegung im Publikum alles richtig. Nur der Sound – ein klein wenig verwaschen – konnte nicht ganz mit der Energie mithalten. Trotzdem: Was für ein Wiedersehen!

APRIL ART sind aktuell einfach der heißeste Scheiß – das lässt sich nicht anders sagen. Die Band aus Gießen ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein Phänomen auf der Schwelle zum ganz großen Durchbruch. Wer sie einmal live erlebt hat, weiß auch sofort, warum: Hier trifft moderne Härte auf Eingängigkeit, Selbstbewusstsein auf Nahbarkeit – und vorneweg eine Frontfrau, die Bühne und Publikum gleichermaßen elektrisiert.
Lisa-Marie Watz wirbelte wie ein Derwisch über die Bühne, schrie, sang, lachte, peitschte das Publikum nach vorn und warf sich mit einer Präsenz ins Rampenlicht, die ihresgleichen sucht. Dabei wirkte nichts aufgesetzt oder überdreht – es war pure Leidenschaft. Ihre Energie sprang wie Strom auf das Infield über, das sich in kürzester Zeit in eine schwitzende, hüpfende Menschenmasse verwandelte.
Der Sound war erstklassig – klar, wuchtig, auf den Punkt. Jedes Riff saß, jedes Break wurde gefeiert, jede Ansage frenetisch aufgenommen. Die Band, bestens eingespielt, zeigte sich von ihrer stärksten Seite und zementierte ihren Ruf als Garant für schweißtreibende Liveshows.
Als dann der neue Song Karma is a Beach angespielt wurde, explodierte die Menge förmlich. Ein echtes Highlight – frisch, modern, mit einem Refrain zum Mitgrölen und genau der richtigen Portion Ironie. Es ist diese Mischung aus Härte, Humor und Haltung, die APRIL ART so besonders macht. Partyspaß pur, ein Publikum in Ekstase und eine Band auf dem Zenit ihrer Livekraft: Das war kein Auftritt, das war ein Statement. APRIL ART haben das Rock Harz im Sturm genommen – und wenn es gerecht zugeht, werden sie bald noch deutlich größere Bühnen beherrschen.


Es gibt Bands, bei denen man von der ersten Sekunde spürt, dass sie selbst dann noch mit 180 Sachen über die Bühne preschen, wenn der Körper eigentlich nach Schonwaschgang verlangt. PRIMAL FEAR gehören genau in diese Kategorie. Dass Bassist und Mastermind Mat Sinner gesundheitlich noch nicht ganz auf der Höhe war – geschenkt. Wer den Mann kennt, weiß: Wenn’s brennt, steht er auf der Bühne. Und brennen tat es – nicht nur in der Sonne, sondern auch im Infield, das schon nach wenigen Takten komplett am Durchdrehen war.
Ralph Scheepers war wie entfesselt, wirkte, als hätte er sich heimlich ein Sauerstoffzelt unter die Bühne gestellt. Fit wie ein Turnschuh, stimmlich über jeden Zweifel erhaben, peitschte er die Massen durch ein Set, das den Begriff „Heavy Metal“ wieder genau dort verortete, wo er hingehört: zwischen Faust, Herz und Stirn. Purer, echter, unverfälschter Metal – keine Frage, dass dieser Auftritt alles war, wofür man sich stundenlang die Sonne auf die Pläte brennen lässt.
Andre Hilgers – frisch im Line-up – trommelte sich ohne Umschweife in die Herzen der Meute, präzise wie ein Zahnarzt mit Motorsäge. Und dann wäre da noch Thalia: Gitarristin, Blickfang, Saitenhexerin. Ein Neuzugang, der nicht nur optisch Akzente setzte, sondern technisch und musikalisch absolut überzeugte. Das Zusammenspiel dieser beiden neuen Kräfte mit den alten Haudegen? Ein wiegendes Hochgebirge aus Melodien und Power. Mat und Ralph lieferten ihre Bass- und Vocal-Linien trocken, ohne zu tropfen – trotz Physio-Mat‑Charm. Magnus? Ein Veteran, wie man ihn sich wünscht: mit einem Blues im Finger und Explosionen in den Riffs.
Der Sound? Roh und massiv, abgemischt wie damals – so dass jedes Zupfen, jeder Schlag, jeder Schrei nach vorne preschte. Eine Performance, die staunen lässt. Andre Hilgers und besonders Thalia sind mehr als Zugaben – sie sind Game-Changer. Trotz Mat’s noch nicht ganz fitter Erscheinung wirkte die Band wie eine frisch geölte Maschine. Ralph war on fire, das Publikum schmolz dahin, die Hitze konnte nichts gegen den Infield‑Tsunami aus echtem Heavy Metal ausrichten. Wer hier nicht abgeht, hat den Herzschlag der Szene verpasst.
Manchmal gibt es ja diese Bands, bei denen man sich fragt, ob man versehentlich auf der Comic Con falsch abgebogen ist. Rhapsody of Fire sind so ein Fall. Bereits beim ersten Ton dachte ich irritiert: „Huch, singt da eine Frau?“ – doch es war schlicht der durchdringend theatralische Tenor von Giacomo Voli, der mühelos jede Kristallkaraffe in der Umgebung zum Bersten brachte.
Was folgte, war eine epische Klangorgie irgendwo zwischen Oper, Bombastkino und Fantasy-Brettspiel. Der Sound? Makellos. Der Pathos? Unerträglich. Zwischen Keyboard-Wellen, Gitarrenläufen in Lichtgeschwindigkeit und orchestralen Einschlägen wurde ein Epos nach dem anderen vom Stapel gelassen – voller Drachen, Schwerter, magischer Amulette und sonstigem feuchtglänzenden Fantasymumpitz.

Die Menge? Völlig losgelöst. Ich? Unfreiwillig fasziniert und gleichzeitig kurz davor, mir in die Rüstung zu brechen. Dieser schleimige Power Metal geht mir nicht nur am Poppes vorbei – er dreht dort noch eine Pirouette. Aber hey: wer auf symphonische Klangtapeten mit Final-Fantasy-Vibe steht, bekam hier die Vollbedienung.
Kaum waren die letzten Glitzersprenkel von Rhapsody verklungen, wurde es nordisch. Kalt. Düster. Oder zumindest innerlich. Denn Insomnium enterten die Bühne mit einem Gesichtsausdruck, als hätte man sie direkt vom Grab ihrer Hoffnung geholt.
Melodic Death Metal aus Finnland – das ist per Definition Weltschmerz in Riff-Form, getragen von tiefen Growls, melancholischen Gitarrenlinien und dieser alles verschlingenden Traurigkeit, die nur Leute jenseits des Polarkreises so glaubhaft vertonen können. Dass dabei draußen 35 Grad und Sonne wie ein Hitzeschwert auf alles niedergingen, sorgte für unfreiwillige Kontraste.
Der Sound war hervorragend, die Band tight und professionell – doch was bleibt, ist das Gefühl, dass mir jemand eine poetische Grabrede auf die Leblosigkeit des Daseins in die Magengrube säuselt, während mein Rücken auf dem durchgeschwitzten Festivalshirt klebt.
Fans feierten die Show, das Infield brodelte – vielleicht auch nur vor Hitzeschock – aber es wurde gefeiert. Ich hingegen fühlte mich, als hätte ich einen kalten Schweinenacken mitten in der Sahara serviert bekommen: eigentlich wohltuend, aber komplett fehl am Platz.
Zwei Acts. Zwei Extreme. Zwei Mal nicht mein Ding. Rhapsody of Fire? Überkandidelter Kitschmetal mit Fantasy-Romantik in Reimform. Insomnium? Trübsalblasen in Moll, hübsch verpackt, aber gefühlt endlos. Beide technisch überragend, beide mit richtig gutem Sound – aber auch beide so weit weg von meinem Geschmack wie ein Flammenwerfer von der Klimaanlage. Und doch: Stimmung im Infield? Großartig. Denn Geschmack ist subjektiv – und gute Laune auf einem Festival kennt bekanntlich keine Genregrenzen.

Manchmal weiß man einfach, worauf man sich verlassen kann – zum Beispiel darauf, dass DARK TRANQUILLITY live immer abliefern. Auch dieses Mal standen die schwedischen Melodic Death-Veteranen mit der gewohnten Souveränität auf der Bühne und feuerten ein Soundgewitter ab, das irgendwo zwischen Eleganz, Aggression und technischer Präzision changierte. Die Band wirkte spielfreudig wie am ersten Tag, der Sound war glasklar und druckvoll, und Michael Stanne – dieses Energiebündel im Dauergrinsmodus – versprühte mal wieder mehr gute Laune als das gesamte Infield an Gin Tonic. Man sah ihm förmlich an, wie sehr er das feiernde Publikum genoss – und das feierte zurück, als gälte es, die schwedische Hymne mit Growls zu untermalen.
Trotzdem muss ich zugeben: So gut das alles war – und es war gut –, hat sich bei mir eine gewisse DT-Müdigkeit eingeschlichen. In den letzten zwei Jahren lieferten sie konstant auf Festivals und Touren ab, und vielleicht ist es einfach zu viel des Guten. Aber dann kommt dieser eine Moment, in dem man sich wieder daran erinnert, warum man diese Band so schätzt. Denn egal wie oft man sie sieht – sie treffen live immer einen Nerv. Manchmal ist Verlässlichkeit eben das, was man am dringendsten braucht. Und DARK TRANQUILLITY sind darin wahre Meister.

CLAWFINGER auf dem Rock Harz – da gingen nicht nur ein paar Hände in die Luft, sondern gleich ganze Generationskonflikte über Bord. Ich für meinen Teil stand mit weit aufgerissenen Augen und breitem Grinsen im Infield, denn: Seit gefühlt 30 Jahren nicht mehr live gesehen. Und da kommt plötzlich diese schwedische Crossover-Legende um die Ecke und tritt derart energiegeladen auf, dass man meint, sie hätten gerade erst ihr Debüt veröffentlicht – jenes Deaf Dumb Blind, das bis heute in regelmäßigen Abständen meine heimische Anlage in Brand setzt.
Schon mit den ersten Takten war klar: Die Truppe ist voll da, das Publikum voll mit – und der Sound: brutal gut. Jeder Ton saß, die Gitarren knurrten wie schlecht gelaunte Wachhunde, und der Bass pumpte wie ein Boxsack beim Intervalltraining. Der charismatische Frontmann Zak Tell hatte Bock, das merkte man ihm in jeder Geste, jedem Spruch und jeder Anekdote an. Zwischen den Songs wurde gelacht, geblödelt und gleichzeitig eine Show abgeliefert, die so tight war wie ein Presswurstpaket kurz vor der Explosion. Besonders spannend: Es gab drei neue Songs auf die Ohren, von denen Scum eindeutig hervorstach – groovig, bissig, einfach typisch CLAWFINGER mit einem modernen Anstrich, der nicht anbiedert, sondern überzeugt.
Ja, sie spielen seit Jahren nicht mehr den Song, der ihnen einst Tür und Tor geöffnet hat, aber heute aus verständlichen Gründen nicht mehr im Repertoire auftaucht. Doch ganz ehrlich: Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil – das Publikum brüllte, tanzte, sprang und feierte die Schweden, als hätten sie nie eine Pause gemacht. Ein rundum großartiger Gig, der in Sachen Energie, Spielfreude und Sound ganz weit oben mitspielte – und hoffentlich nicht wieder für 30 Jahre im Gedächtnis verschwinden muss. Freue mich auf die hoffentlich bald kommende neue Scheibe.

Manche Bands altern wie guter Wein, andere wie offener Joghurt im Hochsommer. Apocalyptica gehören leider zur zweiten Kategorie. Als die finnischen Cellisten einst Mitte der 90er auftauchten, um mit viel Pathos und roher Energie Enter Sandman und Master of Puppets auf klassischen Instrumenten zu verhackstücken, war das in der Tat neu, anders und irgendwie cool. Doch mittlerweile ist das Ganze zur bloßen Selbstkopie verkommen, ein müder Abklatsch einstiger Innovation, der mit jeder Note mehr an Nerven zerrt als an Saiten.
Eigene Songs? Fehlanzeige. Man hat wohl selbst erkannt, dass diese live keine Begeisterungsstürme auslösen – also lieber weiter das alte Metallica-Vermächtnis durch den Cellofilter pressen. Der Sound war zwar klar, aber das half nichts: Es war schlicht langweilig. So langweilig, dass wir kollektiv die Flucht nach vorne antraten – ins Zelt. Endlich wurde es kühler, der Staub legte sich ein wenig, und wir nutzten die Gunst der Stunde, um unsere Inneneinrichtung aufzubauen, die bislang noch wild im Auto verstreut lag. Ein kurzer Abstecher ins Duschcamp rundete das Apocalyptica-Erlebnis ab – frisch, sauber, erleichtert. Warum diese Truppe noch immer prominente Slots bekommt, bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht, weil man sie gut mit Körperpflege oder Möbelrücken kombinieren kann.

Ganz anders dagegen Saxon. Diese Band braucht keine Trends, kein Spektakel, keine Celli – nur Strom, Stahl und Biff Byford. Trotz bevorstehender Operation (alles Gute an dieser Stelle!) präsentierte sich der Grand Seigneur der NWOBHM in absoluter Topform. Kein Anzeichen von Schwäche, keine Spur von Abschiedsstimmung – nur pure, unverfälschte Heavy-Metal-Macht, direkt ins Gesicht geblasen.
Und was für eine Setlist! Schon mit Hell, Fire and Damnation wurde das Festivalfeld in Schwingung versetzt, Power and the Glory zündete wie ein Raketenstart, und bei Dogs of War war die Stimmung endgültig am Siedepunkt. Der Sound? Gigantisch! Jacky, der Mann am Mischpult, hatte das Geschehen voll im Griff und sorgte für ein Druckniveau, bei dem sogar die Harzer Höhenzüge vibrierten.
Ob Heavy Metal Thunder, Strong Arm of the Law oder Denim and Leather – jeder Song ein Treffer, jedes Riff ein Manifest. Bei Wheels of Steel brüllte das Publikum textsicher mit, Crusader wurde zum epischen Höhepunkt, und bei Princess of the Night war ohnehin jeder Widerstand zwecklos. Die Fans lagen der Band zu Füßen, sangen, jubelten, klatschten – eine wahre Huldigung der Metal-Legende.
Apocalyptica? Mehr Fiedel als Feeling. Ein musikalisches Placebo, das weder heilt noch inspiriert. Saxon hingegen lieferten eine Lehrstunde in Sachen Heavy Metal: druckvoll, hymnisch, über jeden Zweifel erhaben. Biff, du alter Recke – viel Glück bei der OP, wir erwarten dich zurück. Und zwar mit Power and the Glory.

Um ehrlich zu sein: Die Luft war raus. Nicht weil die Sonne erbarmungslos vom Himmel brannte – der Gig fand um halb 1 Uhr nachts statt – sondern weil uns der Tag bereits jegliche Energiereserven ausgesaugt hatte. Literweise Schweiß waren schon in die Festivalerde gewandert, 26.000 Schritte lagen hinter uns, der Rücken schmerzte, die Füße jaulten. Doch immerhin: Es war keine Sonne mehr da, dafür eine angenehmere nächtliche Kühle, die zumindest dafür sorgte, dass die Shirts nicht mehr ganz am Körper klebten.
SOULFLY scherten sich wie immer herzlich wenig um das körperliche Elend ihrer Zuschauer und ballerten kompromisslos drauflos. Mit Back to the Primitive und No Hope = No Fear ging’s direkt in die Vollen – Max Cavalera, der Groove-Gott mit Palmenzopf und Panzerkettenhals, rief zum Hüpfen auf, und viele folgten diesem Ruf mit der letzten verbliebenen Kraft. Die Moshpits kochten, wenn auch diesmal eher auf kleiner Flamme.

Wir schauten drei Songs. Dann wankten wir. Mit einem fetten Sonnenbrand vom Vortag, der typischen Festival-Bräune („kurzärmeliges Käsebrötchen mit Grillstreifen“) und dem Bedürfnis nach Horizontalität ging es zum Zelt. Noch ein finaler „Abschluss-Saft“ – bei uns mittlerweile ein fest etablierter Begriff für das isotonische Dosenbier am Ende des Tages – und dann fielen wir wie tot ins Bett. Ich persönlich erwachte erst wieder gegen vier Uhr morgens, um meiner Blase Tribut zu zollen – im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen Patrick beim Chronical Moshers allerdings ohne mein Zelt dabei zu demolieren.
Ein großartiger erster Festivaltag war das. Einer, der zwar musikalisch überzeugte, aber zuweilen hart an die Substanz ging. Und SOULFLY? Haben geliefert – auch wenn man sie um diese Uhrzeit eher als Herausforderung denn als Gute-Nacht-Musik bezeichnen sollte.
OLAF
Fotos by André Schnittker & Unser DÖ