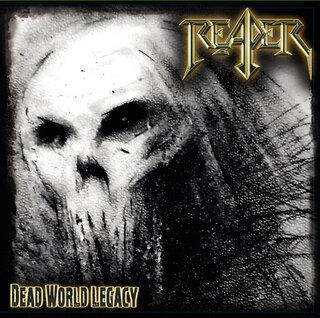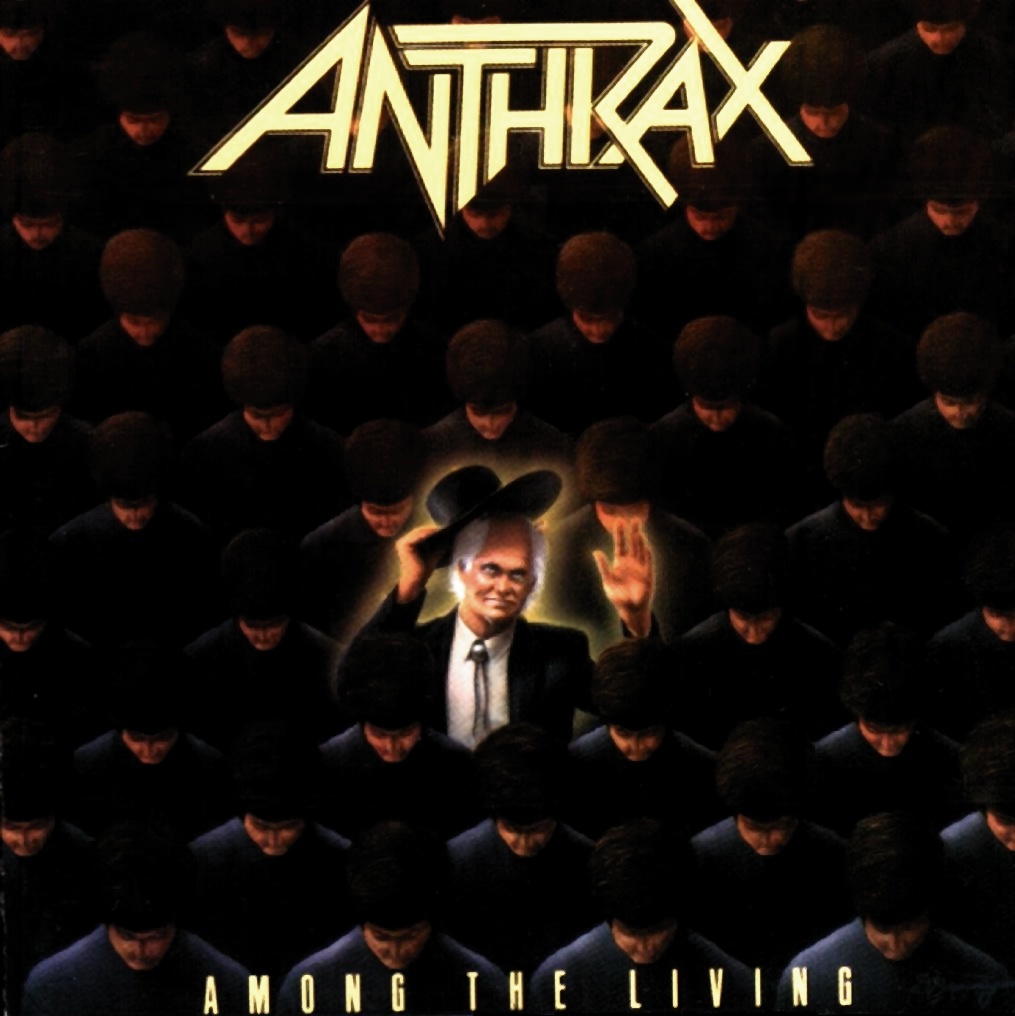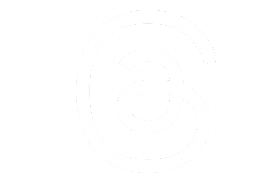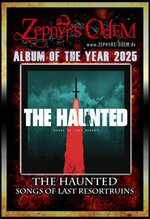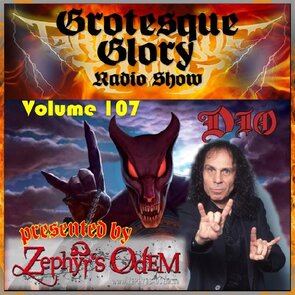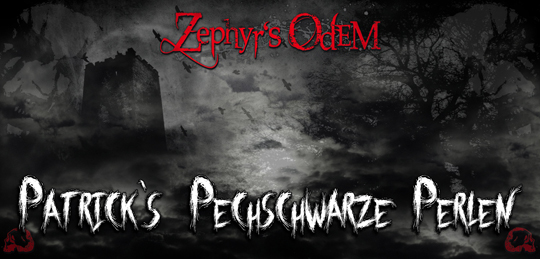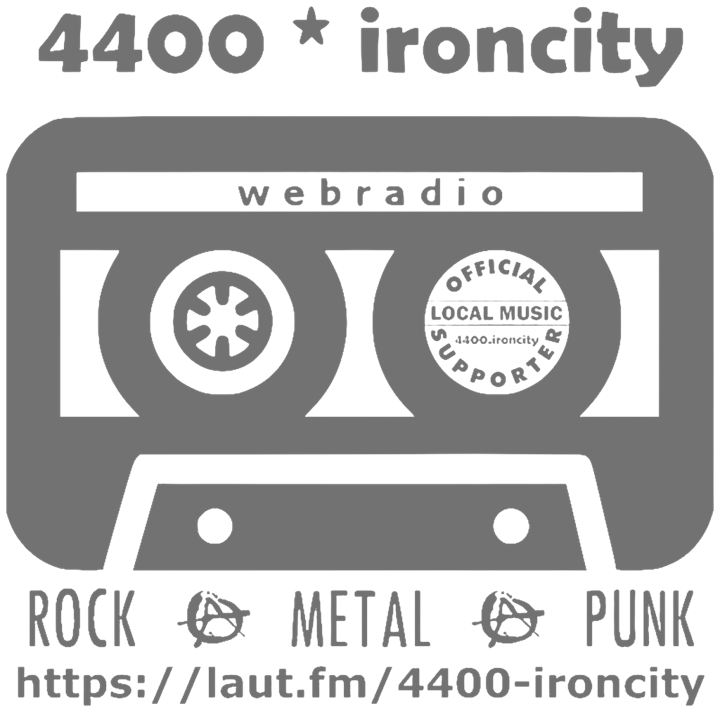DEATH DEALER – Reign of Steel (2026)
(10.033) Olaf (8,5/10) Heavy Metal

Label: Massacre Records
VÖ: 23.01.2026
Stil: Heavy Metal
Manchmal reicht ein einziger Akkord, und du weißt sofort wieder, warum früher regelmäßig die Zimmertür aufflog. Dieses leicht panische „Mach den Krach leiser!“-Gesicht, während du innerlich schon die Luftgitarre polierst und äußerlich so tust, als würdest du Hausaufgaben machen. DEATH DEALER servieren mit Reign of Steel genau dieses Gefühl – traditioneller Heavy Metal, so fett, so kantig, so herrlich unmodern, dass man kurz vergisst, wie viele Plugins heutzutage zwischen Gitarrensaite und Trommelfell stehen. Das ist Heavy Metal, der dir die Nackenmuskulatur nicht nur trainiert, sondern gleich einen Trainingsplan in Lederoptik mitliefert. Und ja: Wenn Judas Priest in ihrer Hochphase versehentlich zehn neue Songs im Proberaum liegen gelassen hätten – es würde ungefähr so klingen.
Schon das Personal ist eine kleine, glänzende Visitenkarte der „Wir-können-das-noch“-Fraktion: Sean Peck am Mikro, Ross „The Boss“ Friedman an der Gitarre, dazu Stu Marshall als zweiter Saiten-Schmied – und hintenrum eine Rhythmussektion, die nicht geschniegelt „begleitet“, sondern mit Nachdruck die Statik des Raums prüft: Mike LePond am Bass und Steve Bolognese am Schlagzeug. Das ist kein Line-up, das sich zufällig an der Käsetheke getroffen hat. Das ist eher so: „Wir bauen heute eine Wand. Aus Stahl. Und dann gucken wir, wer zuerst blinzelt.“
Man merkt Reign of Steel an, dass hier niemand auf „ganz nett“ aus war. Laut Eigenansage wurde lange, hart und detailverliebt daran gefeilt – nicht im Sinne von „wir haben fünf Jahre gebraucht, um uns auf einen Snare-Sound zu einigen“, sondern eher wie Metallarbeiter, die so lange am Schwert schleifen, bis du dich schon beim Hinschauen schneidest. Diese Platte wirkt fokussiert. Keine überflüssigen Spirenzchen, kein Trend-Geklebe, kein „Wir müssen auch mal was Atmosphärisches machen“-Alibi. Stattdessen: Riffs, die schnurgerade marschieren, Refrains, die die Faust automatisch hochziehen, und eine Grundhaltung, die ganz klar sagt: Heavy Metal ist nicht tot – er hat nur kurz die Lederjacke neu eingefettet.
Der Opener Assemble ist dabei nicht einfach ein erster Song, sondern ein Sammelbefehl. Das Ding klingt wie das Tor einer Festung, das aufgestoßen wird: „Alle rein, wir haben Krieg zu führen.“ Direkt danach Devil’s Triangle – und spätestens hier wird klar, dass die Band nicht den Fehler macht, die Klinge erst im zweiten Drittel auszupacken. Das Album funktioniert wie eine Reihe sehr bewusst platzierter Treffer: präzises Riffing, das nicht im Solo-Gewusel ersäuft, sondern immer wieder auf den Punkt zurückkommt, um dir noch einen Tritt in die Rippen zu geben – musikalisch natürlich. Und dann dieser Sound: groß, druckvoll, sehr „in die Fresse“, ohne matschig zu werden. Die Co-Produktion durch Stu Marshall und Sean Peck merkt man im besten Sinne: Hier sitzt jeder Akzent so, als hätte man ihn mit dem Zirkel ins Stahlblech geritzt. Mix und Mastering wirken wie ein Presslufthammer mit Maßband: massiv, aber kontrolliert.
Das große Pfund ist aber die Stimme. Sean Peck singt hier nicht „gut“ – er thront. Dieser Gesang hat die Sorte Autorität, bei der man instinktiv glaubt, der Mann könnte dir sogar die Steuererklärung episch verkaufen. Und ja: Das ist stellenweise wirklich „Ripper Owens in Bestform“-Territorium. Kraft, Höhe, Drama – ohne peinliches Theater. Wenn im Pressetext mit hoch aufragenden Vocals geworben wird, ist das diesmal keine Marketingsprache, sondern eine ziemlich nüchterne Zustandsbeschreibung. Und dieses angedeutete „es könnte hier der längste durchgehende High Scream ever drauf sein“ passt auch zur Attitüde: nicht als Zirkusnummer, sondern als „Wir können’s halt“-Stempel auf glühendem Metall.
Musikalisch lebt Reign of Steel davon, dass DEATH DEALER Tradition nicht als Museum verstehen, sondern als Waffe. Riding on the Wings hat diese klassische, stolze Bewegung – nicht kitschig, sondern wie ein Muskelpaket, das gelernt hat, auch elegant zu laufen. Raging Wild and Free riecht nach verschwitztem Club, Bierdunst und dem Moment, wenn du mit 50 noch so tust, als wärst du 20 – und es funktioniert, weil der Song es dir erlaubt. Blast the Highway ist genau das, was der Titel verspricht: Fahrtwind im Gesicht, aber der Fahrtwind kommt aus einem Schmelzofen.

Und dann gibt’s Bloodbath. Allein der Titel klingt schon nach roten Wänden – und ja: Hier schiebt die Band eine kleine, herrlich untypische Extra-Portion Aggression rein. Ich musste schmunzeln, weil ich bei „Blast“ und „Blood“ erstmal an ganz andere Gefilde denke – und dann erwischt du dich dabei, wie du sagst: „Ey, bei Bloodbath gibt’s sogar Blastbeats – bei so einer Band eher ungewöhnlich.“ Genau so fühlt sich dieser Moment an: als würde dir jemand im Oldschool-Stahlhelm plötzlich einen Turbo zünden. Kein Stilbruch, eher ein kurzer Adrenalinstoß, der das Album noch bissiger macht.
Überhaupt ist diese Platte spannend, packend und heavy as fuck – und dabei erstaunlich „aufgeräumt“. Die Kompositionen sind stark, die Arrangements sitzen, und das Artwork (wirklich ein Brett) passt wie ein Panzerhandschuh aufs Auge: Du siehst das Cover und erwartest genau diese Art Musik. Das ist heutzutage auch eine Kunst – viele Covers schreien „Apokalypse“, und die Musik liefert dann „Playlist-kompatibel“. Hier nicht. Hier ist Stahl drin, wo Stahl draufsteht.
Und jetzt muss ich natürlich noch den Elefanten im Raum streicheln: Wenn der ehemalige Arbeitgeber von Ross the Boss auch nur ansatzweise in den letzten 30 Jahren solche Musik geschrieben hätte, wäre ich vielleicht Fan der lederbeschurzten Majonäse-Truppe. So. Jetzt ist es raus. Denn Reign of Steel hat dieses „Wir meinen das ernst“-Gewicht, das man bei so mancher Legende eher im Merch als in den Songs findet. Ross spielt hier nicht den nostalgischen Namen, sondern liefert genau das, was man von ihm hören will: kantige, hymnische, nach vorne schneidende Gitarrenarbeit – kein Selbstzweck-Gefrickel, sondern Riffs als Rammbock.
Wenn ich überhaupt meckern will, dann nur ganz am Ende: Auf den letzten Metern geht der Platte minimal die Luft aus. Nicht im Sinne von „oh Gott, was ist hier passiert“, eher wie nach einem sehr guten Training, wenn du bei der letzten Übung kurz denkst: „Okay, noch ein Satz… puh.“ Sleeping Prophet und Reign of the Night halten das Niveau, aber das erste Drittel und die Mitte fühlen sich noch einen Tick zwingender an – da ist die Trefferquote gefühlt gnadenloser. Trotzdem: Das ist Jammern auf hohem Stahlniveau.
Unterm Strich ist Reign of Steel genau die Sorte Album, die dich wieder daran erinnert, warum Heavy Metal mal gefährlich wirkte – nicht weil er wirklich gefährlich ist, sondern weil er so kompromisslos Energie freisetzt, dass jede Vernunft kurz in Deckung geht. Es ist perfekt zum Nackenmuskelaufbau geeignet, es macht diesen Raum groß, in dem Pathos nicht peinlich, sondern Pflicht ist, und es hat eine Wucht, die dich grinsen lässt wie ein Teenager mit frisch entdecktem Judas-Priest-Backkatalog. Mutter würde wieder klopfen. Und diesmal würde ich nicht mal leiser machen.
Anspieltipps:
🔥Devil’s Triangle
💀Bloodbath
🎸Blast the Highway
Bewertung: 8,5 von 10 Punkten
TRACKLIST
01. Assemble
02. Devil’s Triangle
03. Riding on the Wings
04. Bloodbath
05. Raging wild and free
06. Blast the Highway
07. Compelled
08. Dragon of Algorath
09. Sleeping Prophet
10. Reign of the Night