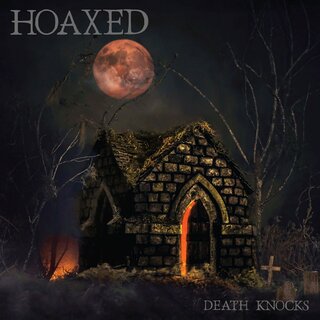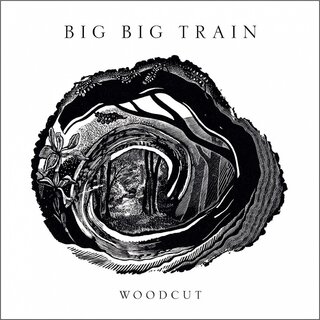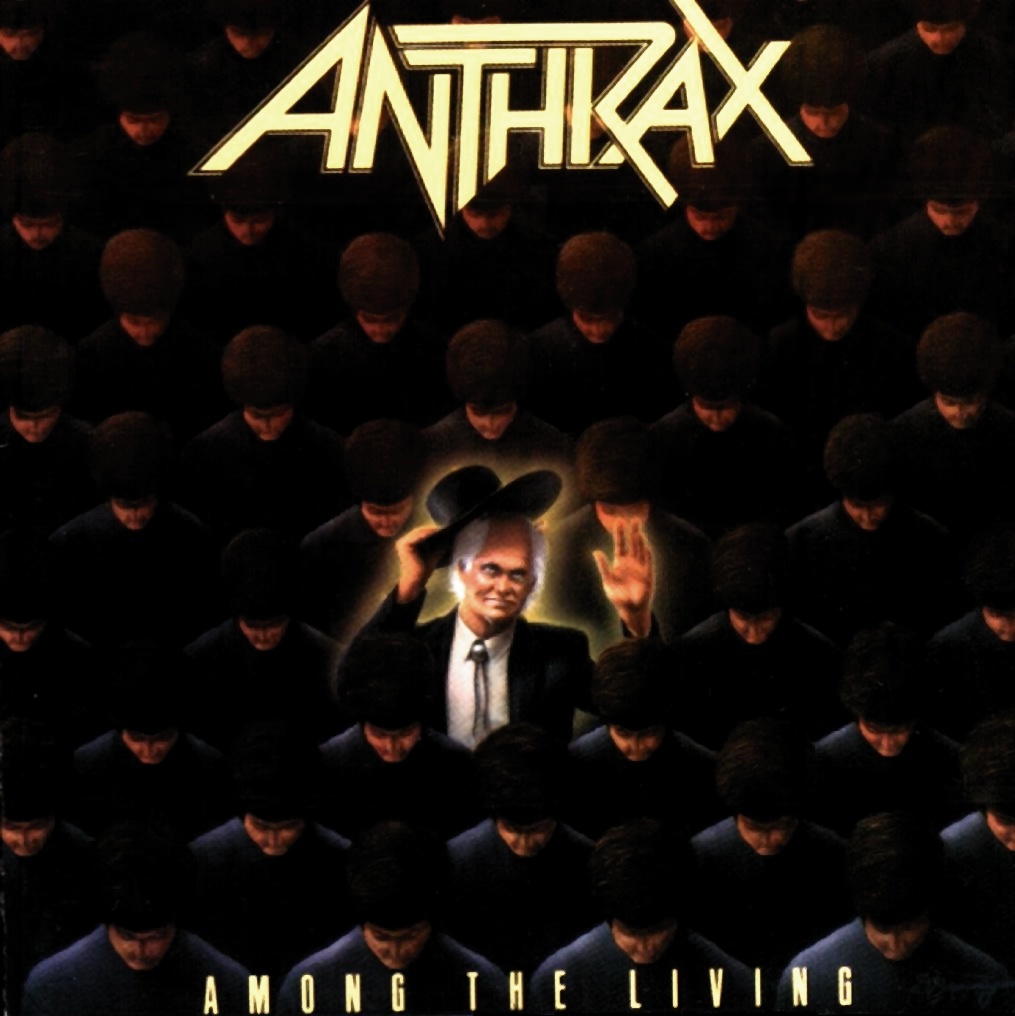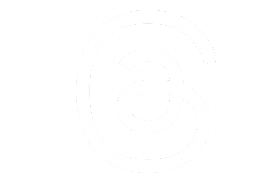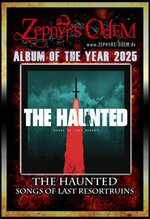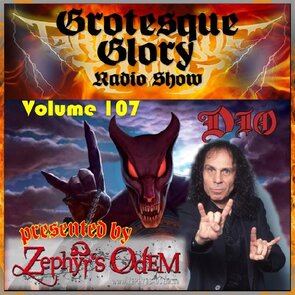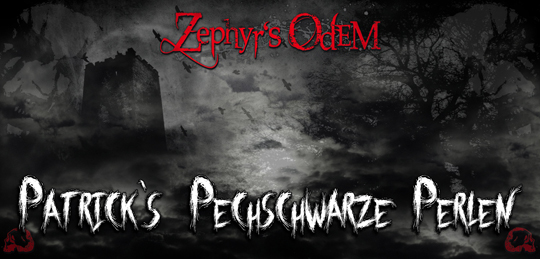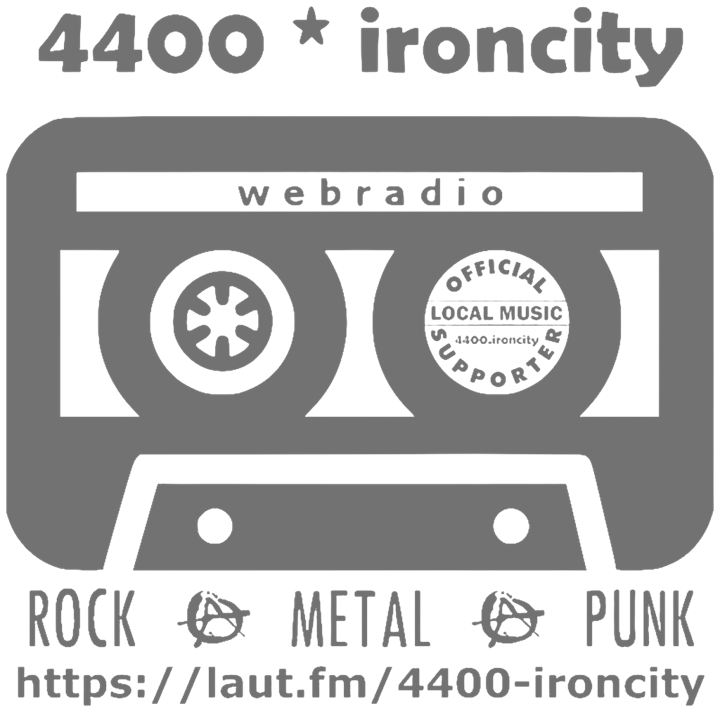Aktuelle Meldungen
Q&A – Das Interview: EXHUMED
Wir sind nicht familienfreundlich!

Wenn man seit 1991 im Death-Metal-Sumpf watet, dabei unzählige Line-up-Wechsel, Tour-Schlachten und tonnenweise Gedärm-Ästhetik überlebt – und am Ende trotzdem noch klingt, als hätte man gerade erst den ersten Skalpellstich gesetzt, dann ist das keine Nostalgie. Das ist Matt Harvey. Und das ist EXHUMED.
Mit Red Asphalt haben Matt und seine Mitstreiter nicht nur ein weiteres Album abgeliefert, sondern ein Konzept geschaffen, das sich irgendwo zwischen Autobahn-Horror, amerikanischer Alltagsrealität und Splatter-Roadmovie bewegt. Zeit also, den Zündschlüssel umzudrehen, den Sicherheitsgurt demonstrativ zu ignorieren – und den Mann zu befragen, der seit Jahrzehnten den Soundtrack zum organischen Verkehrsunfall liefert.
Hey Matt, schön, dass Du Dir die Zeit für uns nimmst. Als Red Asphalt final fertig war: Was war dein erster Gedanke – Stolz, Erleichterung oder dieses typische „Okay… das wird garantiert wieder Ärger geben“?
Weißt du, ich glaube, nach all den Jahren habe ich bei jeder Platte, an der ich arbeite, so einen ganz bestimmten Kreislauf, den ich immer wieder durchlaufe. Am Anfang, mitten im Prozess, bin ich völlig euphorisch. Da denke ich mir: „Alter, das ist so gut. Das ist verdammt nochmal killer. Das bläst alles weg, was wir bisher gemacht haben.“
Dann bin ich überzeugt: Das wird großartig. Ich liebe das Ding. Das wird einschlagen.
Und dann… je näher wir dem Ende kommen – besonders wenn die Mixe zurückkommen und man plötzlich alles in „final“ hört – kippt das Ganze. Auf einmal sitze ich da und denke: „Keine Ahnung… vielleicht ist das hier auch einfach kompletter Bullshit.“ Vielleicht ist es sogar scheiße. Verdammte Axt. Ich weiß es nicht (lacht).
Dann geht dieses Kopfkino los: Wir hätten dies anders machen müssen. Wir hätten jenes anders machen müssen. Und plötzlich wirkt alles wie ein riesiger Fehler. Ich fluche, zweifle, zerdenke jede Kleinigkeit. Und irgendwann… nach einer Weile, wenn ich etwas Abstand gewonnen habe, setze ich mich wieder hin, höre es erneut – und dann denke ich: „Okay. Alles klar. Das ist eigentlich ziemlich gut.“ Und dann kommt automatisch dieser Gedanke hinterher: „Na gut… beim nächsten Mal versuchen wir es eben nochmal besser.“ Es ist wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Ein ständiges Hoch und Runter.
Aber eine Sache, die für mich ziemlich deutlich zeigt, dass wir alle ein starkes Gefühl für diese Platte haben, war diesmal die Setlist. Als wir die zusammengebaut haben, standen da plötzlich sieben Songs vom neuen Album drin. Und ich dachte nur: „Ähm… okay, das ist vielleicht ein bisschen viel.“ Aber genau das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Denn es zeigt, dass wir alle richtig Bock darauf haben, die neuen Songs live zu spielen. Dass da Energie drin ist. Dass wir das Ding nicht nur aufgenommen haben, um es dann im Regal verstauben zu lassen, sondern weil wir wirklich dahinterstehen.
Und ehrlich gesagt fühlt es sich auch so an, als würden die Leute darauf anspringen. Als würde etwas passieren. Und das Beste: Ich glaube, es klingt genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist längst nicht selbstverständlich – das passiert nicht immer. Umso schöner ist es, wenn man am Ende sagen kann: „Ja. Genau so sollte es sein.“

Red Asphalt gilt als Einladung an einen Ort, an dem wir alle viel zu viel Zeit verbringen: die amerikanische Straße – vertraut, aber tödlich. Warum war genau dieses Thema diesmal dein kreativer Zündfunke?
Naja, wie ich schon sagte: Wir machen das jetzt schon eine ganze Weile. Und irgendwann kommt dann automatisch dieser Moment, wo man sich denkt: „Okay… es sind jetzt wieder ein paar Jahre vergangen – vielleicht sollten wir langsam mal über ein neues Album nachdenken.“ Aber wir sind da ehrlich: Wir wollen nichts veröffentlichen, nur weil man es halt „so macht“. Dafür sind wir auch selbst viel zu sehr Fans. Und ganz ehrlich – selbst als Hörer fällt es mir oft schwer, bei vielen Bands über fünf oder sechs Alben hinweg wirklich dauerhaft aufmerksam zu bleiben. Manchmal sogar weniger.
Deshalb war für uns immer klar: Wir machen nur dann eine neue Platte, wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass wir musikalisch und konzeptionell etwas zu sagen haben. Dass da ein Thema ist, ein Funke, eine Richtung – irgendetwas, das uns zwingt, wieder kreativ zu werden. Wenn wir nicht das Gefühl haben, irgendwohin zu können, dann hat ein Album schlicht keinen Sinn. Und dieses Mal ist es tatsächlich ganz natürlich entstanden. Vor allem, weil wir natürlich ständig auf Tour sind. Wir sind immer unterwegs, immer von Ort zu Ort. Letztes Jahr haben wir uns allerdings tatsächlich mal eine Pause gegönnt – ein ganzes Jahr. Und das hatten wir seit 2011 nicht mehr gemacht.
Touren ist ja im Grunde ein völlig absurdes Leben: Du sitzt jeden Tag sechs Stunden im Van, damit du am Ende vielleicht zwei Stunden „arbeitest“ – sprich: spielst. Der Großteil besteht daraus, von einem Ort zum nächsten zu kommen. Du verbringst mehr Zeit auf Autobahnen als auf Bühnen.
Und genau da kam dieser Gedanke auf, den wir immer wieder hatten: „Rockbands schreiben ständig Songs über dieses Leben. Warum machen Death-Metal-Bands das eigentlich nie?“ Und so sind wir auf die Idee der „Road Ballads“ gekommen – also Songs über das Unterwegssein. Es gibt ja unzählige Klassiker darüber: Turn the Page, Free Bird, oder auch Suitcase Blues von Triumph. Dann natürlich Gypsy Road von Cinderella – und gefühlt zehn bis fünfzehn AC/DC-Songs (lacht), die sich ausschließlich darum drehen, irgendwohin zu fahren, irgendwo zu spielen und einfach immer unterwegs zu sein.
Das ist übrigens auch etwas sehr Amerikanisches. Denn hier fährst du überall hin. Alles ist weit, alles passiert auf der Straße. Man lebt quasi im Auto. Und irgendwann haben wir uns gesagt: „Moment mal… es gibt eigentlich keine richtig große Death-Metal-Road-Ballade.“ Also dachten wir: „Na gut – dann schreiben wir eben eine.“
Und je mehr wir darüber gesprochen haben, desto mehr Ideen kamen plötzlich dazu. „Was wäre mit dem Thema? Und was könnte man daraus machen? Und wie wäre es damit?“ Und plötzlich war da nicht mehr nur ein einzelner Songgedanke, sondern eine ganze Welt, die sich auf einmal geöffnet hat. Auf einmal war es so: „Okay… das ist cool. Das hat Substanz.“ Und damit war klar: Jetzt können wir anfangen, wirklich an der Platte zu arbeiten.
Denn das ist bei uns mittlerweile so: Ein Album muss zuerst als Idee existieren. Fast so, als müsste es gedanklich schon da sein, bevor wir überhaupt den ersten Ton schreiben. Und wenn dieses Fundament steht, dann setzen wir uns hin und machen es real.
Songwriting an sich ist für uns mittlerweile kein großes Rätsel mehr. Wir wissen, wie wir klingen. Wir wissen, wie wir schreiben. Wir sitzen nicht mehr da und diskutieren stundenlang darüber, was die Band eigentlich sein soll. Der einzige musikalische Gedanke, den ich diesmal wirklich bewusst hatte, war: Ich wollte, dass wir in den langsameren Passagen etwas offener werden. Etwas schmutziger. Etwas „sleaziger“. Mehr Swagger. Mehr dieses dreckige Selbstbewusstsein, das dich grinsen lässt, während der Song dich trotzdem niederwalzt.
Und letztlich hat sich dann alles gegenseitig gefüttert: Das Tourleben, die Straße, die Idee der Road-Balladen, dieser amerikanische Wahnsinn des ständigen Fahrens – das passte plötzlich alles zusammen. Und daraus ist dann diese Platte gewachsen.

Liegt dem Textkonzept von Red Asphalt eine reale Begebenheit zugrunde – ein Unfall, ein Erlebnis, etwas, das du selbst gesehen oder erlebt hast – oder ist das Album eher ein Sammelbecken aus Highway-Albträumen, die theoretisch jeden treffen könnten?
Im Grunde ist das Ganze eine Art wilder Schmelztiegel aus vielen verschiedenen Dingen – ein Amalgam aus Erlebnissen, Erinnerungen und Einflüssen, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben.
Schon in den 90ern hatten Ross und ich einen ziemlich heftigen Autounfall – und ja, der ging auf meine Kappe. Ich habe damals einen alten SUV überschlagen. Diese Dinger waren in den 80ern ja teilweise echte Todesfallen: viel zu hoch gebaut, komplett kopflastig, miserabel ausbalanciert – ein fahrender Unfallbericht auf Rädern. Und ich war jung, abgelenkt und… na ja, eben dumm und unvorsichtig.
Jedenfalls hat sich der Wagen überschlagen und war danach Schrott. Ross wurde dabei regelrecht unter dem ganzen Zeug begraben, weil wir unser komplettes Equipment hinten im Auto hatten. Wir waren gerade auf dem Heimweg von einem Gig. Ross lag unter einem Berg aus Verstärkern, Cases und sonstigem Kram, und am Ende musste er sogar per Helikopter ins Krankenhaus ausgeflogen werden. Am Ende ging alles glimpflich aus – zumindest im Rahmen dessen, was man „glimpflich“ nennen kann. Ross hat bis heute eine Narbe an der Augenbraue davon. Aber es gab diesen einen Moment, der sich eingebrannt hat.
Ich realisierte plötzlich: Scheiße… das Auto liegt auf dem Dach. Wir kletterten irgendwie raus, und ich dachte nur: Wo zum Teufel ist Ross? Und dann sah ich es – er war einfach verschwunden, begraben unter einem Haufen Equipment. Und in meinem Kopf ging sofort nur ein Gedanke los: Verdammt. Ich habe gerade meinen Freund getötet. Dieser Moment war wie ein Schlag mit dem Vorschlaghammer. Am Ende war es nicht so – zum Glück. Aber diese Szene hat sich festgesetzt. Und ich glaube, sowas beeinflusst einen mehr, als man sich eingestehen will.
Und unabhängig von diesem Unfall gab es noch andere Dinge. Wir alle haben leider auch unsere eigenen Kapitel in Sachen Alkohol am Steuer. Ich wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Sebastian ebenfalls. Und vor vielen Jahren auch Mike, unser Drummer. Und obwohl wir alle wissen, wie unfassbar gefährlich das ist, passiert sowas trotzdem – weil Menschen manchmal eben erschreckend dumm sein können, selbst wenn sie es besser wissen.
Bei mir kommt noch etwas Persönliches dazu: Mein Vater wurde von einem betrunkenen Fahrer angefahren, als ich noch ein kleines Kind war. Ich war vielleicht zwei Jahre alt oder so, also bevor ich überhaupt richtige Erinnerungen habe. Er lag danach im Koma. Das ist eine Geschichte, die wie ein Schatten irgendwo im Hintergrund mitläuft – selbst wenn man sie nicht täglich bewusst denkt. Aber sie ist da.
Und dann gibt es auch Geschichten aus dem Umfeld. Freunde von hatten auf Tour einen furchtbaren Van-Unfall. Dabei landete Ben im Rollstuhl. Solche Ereignisse vergisst man nicht. Sie hängen wie schwerer Nebel über einem, selbst wenn man versucht, sie wegzulachen. Kurz gesagt: Es gab genug persönliche Erfahrungen, aus denen man Inspiration ziehen konnte. Aber es ist eben nicht nur das. Da ist auch die ganze Popkultur, die uns geprägt hat – Filme wie The Hitcher, Road Warrior, Death Race 2000, Werewolves on Wheels, Psychomania… dieser ganze verrückte Kosmos aus Asphalt, Wahnsinn, Gewalt, Motorengeräuschen und schwarzem Humor. Und wir nähern uns solchen Themen ohnehin immer mit einem Augenzwinkern.
Es ist also nicht so, dass wir hier eine Moralpredigt halten wollen. Kein „Fahrt vorsichtig, Kinder“ – kein erhobener Zeigefinger, kein PSA. Es war einfach eine Idee, die sich nahezu von selbst gefüttert hat. Weil man plötzlich merkt: Ach ja, da war das… und da war das… und erinnerst du dich an damals… Alles greift ineinander.
Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu: ein bisschen Gesellschaftskritik, ein bisschen Arbeiter-Thematik, so ein unterschwelliger politischer Unterton. Da gibt es zum Beispiel einen ganzen Song über ein altes amerikanisches Auto, den Ford Pinto. Um ungefähr zwölf Dollar zu sparen, hat Ford den Benzintank direkt hinter die Stoßstange gesetzt. Das Ergebnis: Wenn dir jemand hinten draufgefahren ist, konnte die Karre explodieren. Menschen sind dabei gestorben. Und Ford hat damals kalkuliert, dass es billiger ist, die Klagen der Hinterbliebenen zu bezahlen, als pro Auto diese paar Dollar zu investieren und den Tank einfach an eine sichere Stelle zu setzen.
Auch sowas fließt mit rein. Weil es eben dazugehört. Weil es Realität ist. Und weil es zeigt, wie absurd und brutal „die Straße“ manchmal wirklich sein kann.
Am Ende ist es also ein Mix aus allem: persönliche Erfahrungen, Unfälle, Fehler, Tragödien, Filme, schwarzer Humor und ein bisschen sozialer Kommentar. Und genau deshalb fanden wir das Konzept „Straße“ so stark – weil man daraus wirklich aus jeder Ecke etwas ziehen kann. Es ist ein Thema, das sich wie ein offenes Messer in die Wirklichkeit bohrt… und gleichzeitig genug Raum lässt, um Geschichten daraus zu machen.
Das Video zu Unsafe at Any Speed ist extrem gelungen – aber natürlich auch ein Kandidat für Altersbeschränkung. Hast du das bewusst einkalkuliert nach dem Motto: „Wenn schon, denn schon“?
Naja, wir wussten von Anfang an, dass das Video zu Shovelhead animiert sein würde – und dass es dadurch keinerlei Probleme mit Altersbeschränkungen geben würde. Und genau deshalb hatten wir irgendwie Lust, mal richtig in die unangenehme Ecke zu gehen. Etwas zu machen, das bewusst schäbig wirkt. Abstoßend. Schmierig. So ein Clip, bei dem man sich als Zuschauer kurz fragt, ob man sich danach die Augen mit Spülmittel auswaschen sollte. Und ehrlich gesagt: Es hätte sogar noch viel widerlicher werden können, wenn wir wirklich komplett auf „maximal eklig“ gegangen wären.
Aber dann kam der Regisseur mit seiner eigenen Vision um die Ecke – und wir haben das sofort gefeiert. Wir haben ihm im Grunde nur eine grobe Skizze gegeben, so eine Art Leitplanke. Und er meinte dann: „Was wäre, wenn wir das so und so machen…?“ Und wir nur: „Oh fuck… okay. Das ist großartig.“ Also haben wir ihn einfach machen lassen. Komplett. Freie Fahrt. Und es war extrem cool zu sehen, was er daraus gebaut hat. Ich liebe vor allem diesen Punkt: Das Genre, in dem wir uns bewegen, gibt es nun schon ewig. Es ist heutzutage verdammt schwer, noch wirklich zu schocken oder Leute aus der Komfortzone zu prügeln. Aber ich mag, dass dieses Video genau das schafft – weil es auf eine Art abstoßend ist, mit der man nicht rechnet.
Denn mal ehrlich: Man denkt ja nicht automatisch „Oh, Menschen küssen sich… wie widerlich.“ Und dann siehst du den Clip und plötzlich sitzt du da und denkst: „Mein Gott… oh Jesus… was zur Hölle passiert hier gerade?“(lacht) Und genau das macht Spaß. Es ist einfach großartig, Wege zu finden, Dinge unangenehm und hässlich wirken zu lassen – auf eine kreative, verdrehte Art. Denn ganz ehrlich: Ich will nicht, dass diese Musik zu nett wird.
Ich will nicht, dass eine EXHUMED-Platte geschniegelt, geschniegelt und geschniegelt klingt. Nicht geschniegelt. Nicht steril. Nicht „familienfreundlich“. Und weil wir eben wussten, dass Shovelhead als animiertes Video problemlos für alle Altersstufen durchgeht, war klar: Dann nehmen wir uns hier die Freiheit und drehen den Clip bewusst in diese schleimige, schmutzige Richtung. Beide Videos machen Spaß – keine Frage. Aber das eine ist eher komplett durchgeknallt und irre… und das andere ist eben: richtig schmierig. Richtig eklig. Und genau so soll es sein.
Bei Signal Thirty nimmst du einen Polizeicode als Aufhänger: Wie tief bist du für das Album in Unfallberichte, Highway-Statistiken, Notfallcodes und diese ganze Welt rund um den Asphalt des Grauens eingetaucht?
Wir sind gar nicht so tief in die statistische Seite des Ganzen eingestiegen – aber dahinter steckt tatsächlich eine komplette Kultur, die ihren Ursprung eigentlich schon in unserer Jugend hatte und irgendwann langsam auslief. Denn ungefähr von den 50ern bis hinein in die 90er existierte in den USA eine regelrechte Tradition, sogenannte „Schockfilme“ zu produzieren, die gezielt Schülern gezeigt wurden. The Iron Graveyard ist einer davon, Signal 30 ist einer, und Red Asphalt gehört ebenfalls in diese Kategorie.
Man zeigte diese Filme Jugendlichen, bevor man ihnen das Autofahren beibrachte – quasi als visuelle Abschreckungstherapie. Und das war nichts für zarte Mägen: Da sah man verstümmelte Leichen, die aus Wracks gezogen wurden, Blut, abgerissene Gliedmaßen, Menschen, die bei Unfällen buchstäblich auseinandergerissen wurden. Und es war damals absolut keine Seltenheit, gerade in den 50ern und 60ern, dass Schüler im Klassenzimmer ohnmächtig wurden, sich übergeben mussten oder sogar hinausgetragen wurden.
Und ehrlich gesagt: Noch bevor in den 60ern die Ära der Herschel-Gordon-Lewis-Horrorstreifen begann, waren diese Verkehrssicherheitsfilme vermutlich einige der blutigsten und grausamsten Filme, die überhaupt existierten. Filme wie Signal 30 oder Red Asphalt waren damals wahrscheinlich das Maximum dessen, was man an Gore überhaupt zu sehen bekam – und das lief nicht im Kino, sondern direkt in der Schule. Quasi Splatterunterricht mit benoteter Anwesenheit (lacht).
Natürlich: Horrorfilme und blutige Inhalte wurden inzwischen totgeritten – genauso wie Death Metal von uns und gefühlt tausend anderen Bands. Aber genau dieses spezielle Segment dieser „Shock-Filmmaking“-Kultur hatte irgendwie noch niemand so richtig aufgegriffen. Und das fanden wir fast schon seltsam. Es war wie ein verstaubtes Regal voller Albträume, das niemand mehr angefasst hat. Also dachten wir: Perfekt. Das ist genau der Platz, wo wir reingrätschen können.
Und ja: Signal 30 ist tatsächlich der alte Code für tödliche Verkehrsunfälle. Das hatte sofort etwas Düster-Faszinierendes. Von Red Asphalt wusste ich natürlich schon – schließlich war das der Titel, den ich selbst für den Titeltrack des Albums gewählt hatte. Ross hingegen stieß dann auf Signal 30 und The Iron Graveyard. Und ironischerweise fand ich erst danach – nachdem er diese Sachen schon ausgegraben hatte – eine komplette Dokumentation über solche Verkehrssicherheitsfilme. Da wurde mir klar: „Verdammt… das ist ja ein ganzes Universum.“ Und Ross hatte die wichtigsten Teile längst entdeckt.
Aber gut – wir sind eben beide ziemliche Nerds. Bevor wir überhaupt in die Musik eingestiegen sind, waren wir Comicbook-Fans. Und ich glaube, diese „Recherche-im-Bibliotheksmodus“-Ader steckt einfach tief in uns drin. Dieses leicht dorkige Bedürfnis, alles zu durchforsten, jede Ecke auszuleuchten und sich in Themen so lange reinzugraben, bis man am Ende selbst aussieht wie ein wandelndes Lexikon. Und ganz ehrlich: Genau das hilft uns enorm beim Schreiben unserer Alben. Diese Art von obsessiver Neugier ist manchmal vielleicht unerquicklich – aber sie ist Gold wert, wenn man aus Ideen ein Konzept macht.
Das Album entstand an mehreren Orten (Darker Corners, zusätzliche Gitarren in Maryland, Bass/Vocals in Oakland): War das rein organisatorisch bedingt oder hat diese „verstreute Produktion“ das Road-Feeling des Albums sogar verstärkt?
(lacht) Die zweite Option klingt ehrlich gesagt deutlich besser. Im Grunde haben wir uns aber vor ein paar Jahren hier unser eigenes Studio aufgebaut – Darker Corners in San Luis Obispo. Genau hier sitze ich gerade. Damals war der Plan, dort unser Horror-Material aufzunehmen, und seitdem läuft bei uns ein großer Teil der Aufnahmen genau hier ab. Das grundlegende Tracking – also das Fundament – entsteht in diesen vier Wänden.
Sebastian, unser zweiter Gitarrist, hat allerdings sein eigenes Studio in Baltimore. Und wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet: Zeitlich hätte es einfach keinen Sinn ergeben, ihn hierher zu holen, damit er neben mir sitzt, während ich erst sämtliche Rhythmusgitarren einspiele, nur damit er danach endlich seine Soli aufnehmen kann. Sobald unser Gitarren-Tracking-System stand, war für mich klar: Okay, ich bin startklar – ich zieh das jetzt einfach durch. Ich kann die Rhythmusgitarren hier komplett selbst aufnehmen, und Sebastian ergänzt dann später von Baltimore aus alles, was noch fehlt oder was er beisteuern will. Das funktioniert mittlerweile erstaunlich gut.
Und dann kommt Ross ins Spiel. Sobald Rhythmusgitarren und Drums im Kasten sind, steigt er ein und nimmt den Bass auf. Ross ist allerdings… sagen wir mal… speziell. Er macht das am liebsten komplett alleine. Ich persönlich finde es deutlich angenehmer, wenn jemand dabei ist – es macht mehr Spaß, es hat mehr Energie. Aber Ross? Der ist da eigen. Der liebt es, sich zu Hause einzuschließen und einfach sein Ding durchzuziehen. Also nimmt er seine Bassspuren daheim in Oakland auf.
Und ganz ehrlich: Die Technik hat sich in den letzten 25 Jahren so drastisch weiterentwickelt, dass es heute kaum noch Grenzen gibt. Recording ist nicht nur besser geworden, sondern auch viel erschwinglicher. Wir können inzwischen Ergebnisse auf professionellem Niveau abliefern, ohne dass alle gleichzeitig an einem Ort sein müssen. Kein Zwang mehr nach dem Motto: „Wir müssen alle für einen Monat in ein Studio, alles aufnehmen, fertig, Schluss.“
Heute können wir das Ganze flexibel angehen – Schritt für Schritt, wann immer es passt. Klar, das hat auch seine Nachteile, weil man nicht immer dieses klassische „Band-im-Raum“-Gefühl hat. Aber unterm Strich ist es ein riesiger Vorteil. Vor allem, weil es uns Freiheit gibt – und Freiheit ist manchmal das beste Werkzeug im Studio.

Der Mix von Scott Evans ist brutal, aber gleichzeitig sehr transparent, und das Mastering von Leon del Muerte setzt dem Ganzen die finale Rasierklinge auf: Wie wichtig war dir diesmal dieser Spagat zwischen Dreck und Druck?
Das war wirklich ein extrem wichtiger Punkt, weil ich glaube: Als wir 2011 zurückkamen und die ersten paar Platten gemacht haben, war es einfach verdammt beruhigend zu wissen, dass wir überhaupt eine gute Produktion hinbekommen können. Denn gerade am Anfang war das eine echte Herausforderung. Und heute – mit der ganzen Entwicklung der Aufnahmetechnik – habe ich wirklich das Gefühl, dass du inzwischen fast immer eine gute Produktion bekommen kannst. Eine klare Produktion. Das ist eben nicht mehr wie in den 80ern oder selbst noch in den 90ern, wo es oft hieß: „Keine Ahnung, geh halt in das Studio in deiner Stadt…“
Und dann sitzt da irgendein Typ hinterm Mischpult, der normalerweise Hair Metal oder Grunge aufnimmt – und absolut keinen blassen Schimmer hat, was er mit Blastbeats oder diesem ganzen Irrsinn anfangen soll. Heute ist das anders. Heute kannst du dir einen richtig starken Sound holen, ohne dass du erst beten musst, dass der Produzent nicht bei Doublebass schon die weiße Fahne hisst.
Und nachdem wir die ersten paar Platten nach dem Comeback gemacht hatten – also All Guts, No Glory und Necrocracy – lag die Herausforderung plötzlich ganz woanders: Wie macht man ein Album, das professionell klingt, fett produziert, druckvoll und sauber… aber trotzdem nicht wie jedes andere Album? Und vor allem: nicht zu steril, nicht zu geschniegelt, nicht zu „klinisch“. Ich glaube sogar, dass wir bei der letzten Platte vielleicht ein Stück zu weit in die rohe, dreckige und schmierige Richtung gegangen sind. Und deswegen war bei diesem Album von Anfang an klar – sowohl für Ross als auch für Sebastian – dass wir Scott fürs Mixing haben wollten. Das war quasi der Plan, der Weg, die Richtung.
Und ich finde, das funktioniert verdammt gut, weil die Platte immer noch lebendig klingt. Man hört, dass da Menschen spielen. Keine Maschinen. Keine sterilen, glattgebügelten Clicktrack-Roboter. Ja, es ist tight, es ist präzise, es ist hoffentlich auch gut gespielt – aber eben nicht totproduziert. Wir wollten nicht in dieses „chirurgische“ Arbeiten abrutschen, wo du jede einzelne verdammte Note nachträglich glattfeilst, bis alles geschniegelt und geschniegelt und geschniegelt ist. Ich hab solche Produktionen schon gemacht. Und klar – am Anfang wirkt das beeindruckend: „Wow, ist das sauber. Wow, ist das clean.“
Aber mittlerweile klingen einfach viel zu viele Alben genau so: geschniegelt, geschniegelt, geschniegelt… fast schon höflich. Und Höflichkeit ist nun wirklich das Letzte, was ich von einer Death-Metal-Platte will. Das ist für mich wie ein Pitbull mit Schleife. Und ja, natürlich: Das ist nicht meine Band, andere können machen, was sie wollen. Und diese Art von Produktionen verkauft sich offenbar großartig – also mögen es die Leute offensichtlich. Aber ich persönlich? Ich mach Platten für mich.
Und genau deshalb ist dieses Gleichgewicht so entscheidend: Dreck, Rohheit, Klarheit und Power unter einen Hut zu bringen – das ist die ganze Kunst. Denn Klarheit kannst du immer bekommen. Du kannst das Ding bis zur Unkenntlichkeit mastern, es brutal laut machen, so dass es beim ersten Hören wirkt wie ein Presslufthammer direkt ins Trommelfell.
Aber dann passiert oft genau das: Der Effekt nutzt sich schnell ab. Es klingt am Anfang „mächtig“, aber nach kurzer Zeit wird alles gleichförmig, homogen, austauschbar. Wie eine Wand aus Lärm, die irgendwann keine Konturen mehr hat. Und ganz ehrlich: Genau darauf hab ich einfach keinen Bock.
Für mich ist Red Asphalt tatsächlich euer bestes Album – und das nach 36 Jahren Bandgeschichte: Siehst du das ähnlich, oder würdest du dich selbst eher bremsen und sagen „das Urteil überlassen wir der Blutspur“?
Weißt du, das ist immer so eine Sache. Einerseits ist es bei jeder neuen Platte so, dass ich während des Schreibens und Aufnehmens automatisch denke: „Ja, Mann… das wird unser bestes Album.“ Und ganz ehrlich – das muss auch so sein. Denn wenn ich nicht wirklich daran glauben würde, dass wir gerade unser stärkstes Werk erschaffen, dann müsste ich mich fragen, warum ich mir das überhaupt antue. Warum sollte ich all diese Energie investieren, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es das Beste wird, was wir je gemacht haben? Und ja – ich fühle mich bei diesem Album wirklich gut.
Aber am Ende des Tages ist es eben auch nicht meine Entscheidung, welches Album unser bestes ist. Sobald die Platte fertig ist, gehört sie irgendwie nicht mehr wirklich uns. Dann ist sie draußen in der Welt, und ab diesem Moment ist sie nicht mehr nur unser Ding. Sie wird auch zu deinem. Wenn du sie hörst, dann ist sie auch ein Stück weit deine Platte. Und wenn du sie liebst – perfekt. Dann ist alles genau so gelaufen, wie wir es uns erhofft haben. Und wenn du sie nicht liebst… tja, fuck. Dann ist das eben so. Dann machen wir halt noch eine (lacht).
Natürlich hoffen wir, dass sie dir gefällt. Und für mich persönlich ist es sowieso so: Das beste Album wird immer das nächste sein. Das ist irgendwie mein Antrieb. Aber trotzdem glaube ich wirklich, dass dieses Album ein starkes geworden ist. Und das ist nicht nur mein eigenes Bauchgefühl – auch Menschen, denen ich vertraue, scheinen es richtig gut zu finden. Ich habe da ein paar Freunde, die ich schon ewig kenne. Leute, die mir nicht nach dem Mund reden. Die würden niemals einfach nur höflich nicken. Im Gegenteil – die sagen mir auch knallhart ins Gesicht: „Warum hast du das gemacht? Das ist doch völliger Quatsch.“ Und dann sitze ich da und denke mir: „Oh scheiße… okay.“
Manchmal versuche ich dann zu erklären, warum ich etwas so gemacht habe, und manchmal bleibe ich auch dabei und sage: „Ja, genau deshalb. Und ich würde es wieder genauso machen.“
Und dann kommt als Antwort nur: „Egal. Ich find’s trotzdem scheiße.“(lacht) Und weißt du was? Genau dafür bin ich dankbar. Weil es unglaublich wertvoll ist, ehrliches Feedback zu bekommen – und zwar von Leuten, die man respektiert. Nicht von irgendeinem Random-Heini in den YouTube-Kommentaren, der sowieso alles hasst, was nicht nach exakt seinem Geschmack klingt. Wenn der keinen Bock drauf hat: okay, dann soll er’s halt nicht hören. Fertig.
Aber echte, ehrliche Kritik von Menschen, die einem wichtig sind und die einen kennen – das ist Gold wert. Und trotzdem: Ich glaube wirklich, dass dieses Album ein verdammt starkes geworden ist. Ich glaube, wir alle glauben daran. Wir stehen dahinter. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es auch bei den Leuten da draußen zündet. Und ja… hoffentlich hast du recht. Hoffentlich ist es wirklich unser bestes Album.
Wenn du Red Asphalt in einem Satz beschreiben müsstest: Ist es eher ein Splatter-Roadmovie in Musikform, eine böse Satire auf den „American Dream“ oder schlicht ein Death-Metal-Album über den Tod im Alltag?
Ich würde sagen, das ist eine Deathgrind-Roadballade – nur eben nicht in drei Minuten, sondern als richtiges Langformat. Eine schleifende, mahlende Roadballade aus Death Metal und Grind, die sich wie ein Trip über endlose Highways anfühlt: mit Höhen und Tiefen, mit Momenten, in denen man den Kopf aus dem Fenster hält und denkt: Verdammt, das Leben ist gut. Einige Songs wirken dabei fast schon feierlich, geradezu triumphierend – als würde man nachts bei Vollgas über die Interstate donnern und das Adrenalin direkt in die Blutbahn pumpen.
Andere Stücke hingegen sind eher wie Warnschilder am Straßenrand: kleine, düstere Geschichten, die einem klarmachen, dass so ein Roadtrip eben nicht nur Freiheit bedeutet, sondern auch Risiko, Absturz und die dunklen Seiten des Unterwegsseins. Genau wie im echten Leben: mal fühlt sich alles wie ein Sieg an, mal wie eine Lektion, die man lieber nicht gebraucht hätte.
Und ja – ich will wirklich nicht dauernd auf diesem „amerikanischen Ding“ herumreiten, vor allem in Zeiten, in denen Patriotismus schnell wie ein schlechter PR-Gag wirkt. Aber dieses ganze Motiv von Straße, Weite, Freiheit und Gefahr… das ist irgendwie zutiefst amerikanisch. Dieses romantisierte Bild vom offenen Highway, vom Aufbruch ins Unbekannte, von der Sehnsucht nach dem Horizont – das geht zurück bis in die Frontier-Zeit, zu Cowboys, Staub, Gesetzlosigkeit und dem Gefühl, dass hinter der nächsten Kurve entweder das Glück oder der Tod wartet. Genau diese spezielle Art von Straßenromantik steckt da drin.
Also ja: eine epische, langgezogene Deathgrind-Roadballade – rau, dreckig, gefährlich… und irgendwie verdammt poetisch, wenn man den Lärm erstmal durchdrungen hat.
Das war jetzt aber mehr als ein Satz…(lacht laut) Was macht das aktuelle Line-up (du, Ross Sewage, Mike Hamilton, Sebastian Phillips) für dich so stark – und was konnte diese Besetzung liefern, was frühere Phasen nicht konnten?
Ich meine, es gibt da viele Dinge – aber eine stabile Besetzung zu haben, ist einfach unbezahlbar. Denn das war früher ehrlich gesagt nie wirklich der Fall. Es hat uns eine ganze Weile gekostet, überhaupt herauszufinden, wie zum Teufel man eine Band dauerhaft zusammenhält, ohne dass ständig jemand abspringt oder alles wieder von vorne beginnt.
Und es geht dabei nicht nur um Musik, sondern auch um etwas ziemlich Unromantisches: Planbarkeit. So etwas wie finanzielle Vorhersehbarkeit. Nicht, dass hier irgendjemand reich werden würde – davon sind wir Lichtjahre entfernt. Aber zumindest wissen wir inzwischen, wie das Ganze läuft. Wenn du auf Tour gehst, dann kannst du danach auch wieder nach Hause kommen und deine Rechnungen bezahlen. Das klingt banal, ist aber für viele Bands im Underground ein Luxus, der fast schon wie Science-Fiction wirkt. Wir haben also irgendwann die geschäftliche Seite in den Griff bekommen – und ab da ist es im Grunde wie bei jedem anderen Team auch.
Du brauchst Leute, die die Musik lieben und sie spielen können, klar. Aber du brauchst auch Menschen, deren Fähigkeiten sich ergänzen. Denn was ich über die Jahre gelernt habe: Wenn alle dasselbe Skillset mitbringen, tritt man sich irgendwann nur noch gegenseitig auf die Füße. Dann kämpfen alle um denselben Raum, dieselbe Aufmerksamkeit, dieselbe kreative Luft zum Atmen. Und genau deshalb funktioniert das bei uns mittlerweile so gut. Sebastian und Ross sind großartige Songwriter – aber das ist nicht ihr Hauptfokus, zumindest nicht in dieser Band. Und genau das ist eigentlich perfekt. Es ist super, dass sie Songs schreiben wollen, aber es ist eben nicht so, dass wir uns ständig gegenseitig überrennen oder darum ringen, wessen Idee jetzt unbedingt die wichtigste ist. Wir stehen uns nicht im Weg – wir treiben uns an.
Sebastian ist zum Beispiel auch ein besserer Audio Engineer als ich. Das heißt, er hilft massiv im Studio-Prozess, bringt Know-how rein, das ich so nicht habe. Jeder bringt etwas Eigenes mit, jeder zieht in dieselbe Richtung, und am Ende ergänzt sich das Ganze wie Zahnräder in einer gut geölten Maschine. Und vielleicht das Wichtigste: Wir mögen uns. Wirklich. Wir vertrauen einander, respektieren uns, und das ist in einer Band mindestens so viel wert wie ein fettes Riff oder ein perfekter Drumfill.
Und ja – wir haben einfach Spaß miteinander. Denn am Ende gilt: Auch wenn unsere finanzielle Situation besser ist als bei vielen anderen Underground-Death-Metal-Bands… wir werden trotzdem nicht verdammt reich. Nicht mal ansatzweise. Und wenn man schon nicht reich wird, dann sollte man wenigstens verdammt nochmal Freude daran haben, was man tut. Und genau das haben wir. Wir mögen uns ehrlich. Wir lachen zusammen. Wir funktionieren zusammen. Und ich fühle mich wirklich glücklich, in dieser Position zu sein – weil das alles andere als selbstverständlich ist.

Gibt es bei EXHUMED überhaupt noch kreative Grenzen – oder lautet die Regel längst: solange es stinkt, blutet und groovt, ist es erlaubt?
(lacht laut) Als wir Kids waren, war EXHUMED quasi meine… na ja, meine Schulband – und ausgerechnet die ist dann irgendwie einfach nie gestorben. Die läuft halt immer noch. Damals hatten wir uns selbst so viele Regeln auferlegt. So nach dem Motto: Jeder Song muss einen Blastbeat haben, wir müssen dies machen, jenes machen, hier noch einen Break, da noch ein völlig überdrehtes Tempo – eben dieses typische jugendliche „Mehr ist mehr“-Denken.
Aber heute… nach all den Jahren, nach so vielen Platten, Touren und Studio-Sessions, fühlt sich das alles nicht mehr so an, als müssten wir uns an irgendwelche selbst gebastelten Gesetzestafeln halten. Wir machen einfach Musik – und wenn wir etwas schreiben, merken wir ziemlich schnell, ob es sich nach uns anfühlt. Ob es nach EXHUMED klingt. Und genau das ist der Punkt: Es passiert mittlerweile so natürlich, dass wir gar nicht mehr in diesen Kategorien von Regeln denken.
Das Wichtigste ist für mich inzwischen eher, dass wir konsequent bleiben. Ich will keinen kompletten Stilbruch hinlegen – kein musikalisches „Cold Lake“-Szenario, wo plötzlich alles fremd wirkt und man sich fragt, ob die Band aus Versehen ausgetauscht wurde. Selbst wenn so ein Album vielleicht funktionieren könnte: Ich habe einfach kein Interesse daran, eine drastische Kehrtwende zu machen. Ich mag den Stil, in dem wir uns bewegen. Und wenn ich irgendwann wirklich etwas komplett anderes machen will, dann mache ich das eben in einer anderen Band. Wir wollen unserem Sound treu bleiben – aber gleichzeitig soll jede neue Platte trotzdem ihren eigenen Charakter haben. Und genau das ist die eigentliche Herausforderung: vertraut bleiben, ohne sich zu wiederholen. Wiedererkennbar sein, ohne zur eigenen Kopie zu verkommen.
Aber weißt du was? Das ist eine verdammt gute Herausforderung. Eine, die Spaß macht. Und alle paar Jahre schaffen wir es hoffentlich wieder, einen Weg zu finden, das umzusetzen – so, dass es uns selbst spannend vorkommt… und genauso spannend für die Leute bleibt, die uns zuhören.
Wenn du heute eine Fahrprüfung machen müsstest: würdest du bestehen – oder würdest du wegen „zu großer Begeisterung für vehicular homicide“ direkt durchfallen?
(lacht) Ich glaube schon, dass ich meine Begeisterung während der Fahrprüfung halbwegs im Zaum halten könnte – hoffe ich zumindest. Wobei das Ganze irgendwie schon eine gewisse Ironie hat: Ich habe meinen Führerschein erst vor Kurzem verlängern lassen. Ich bin gerade 50 geworden und habe inzwischen eine Lesebrille, weil die Augen eben auch nicht jünger werden. Und ich musste dabei schmunzeln, weil die Verlängerung ganz automatisch durchging – ohne dass ich nochmal zur Prüfung antreten musste.
Denn zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich wirklich: Verdammt… vielleicht brauche ich beim Sehtest tatsächlich eine Brille. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Wenn die nächste Verlängerung ansteht, wird’s vielleicht spannend. Oder auch nicht. Aber irgendwas sagt mir: Die Augen werden dann jedenfalls nicht besser sein als heute.
Die berühmten letzten Worte gehören dir: Was möchtest du unseren Leserinnen und Lesern mitgeben, bevor sie den Motor starten und Richtung Route 666 verschwinden?
Danke, dass ihr dieses Interview gelesen habt. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und euch wirklich für die Band interessiert, dann freut es uns umso mehr – denn wir sind verdammt heiß darauf, dieses Jahr endlich wieder nach Europa zurückzukehren. Und ja: Wir können es kaum erwarten, euch mit auf diesen Roadtrip aus der Hölle zu nehmen. Das wird kein netter Sonntagsausflug mit Kaffee und Streuselkuchen – das wird laut, schweißtreibend, dreckig und genau so, wie es sein muss. Es wird eine verdammt gute Zeit. Wir sehen uns da draußen.
Matt, vielen Dank für deine Zeit und für ein Album, das nicht nur brutal nach vorne prescht, sondern gleichzeitig auch ein überraschend starkes Konzept besitzt. Red Asphalt klingt wie ein Deathgrind-Roadmovie, bei dem man gleichzeitig lachen, zusammenzucken und headbangen muss – und genau diese Mischung macht EXHUMED seit Jahrzehnten einzigartig. Wir wünschen dir und der Band maximale Power für die kommenden Shows, sichere Reifen, stabile Bremsen und möglichst wenige unfreiwillige Crash-Test-Momente. Und falls doch: Hauptsache, es klingt danach.