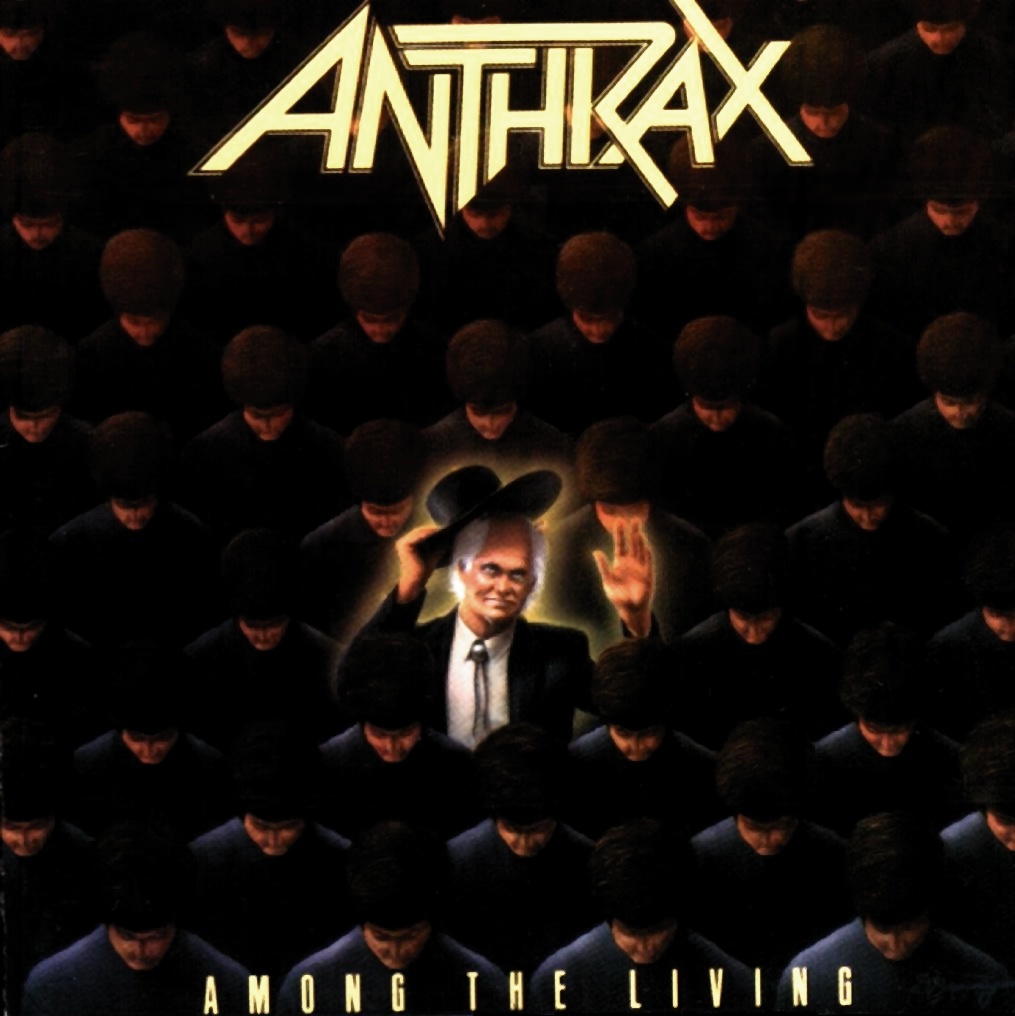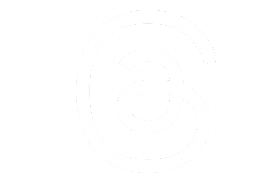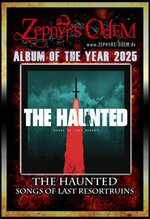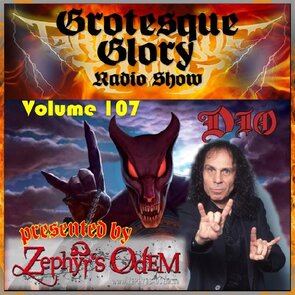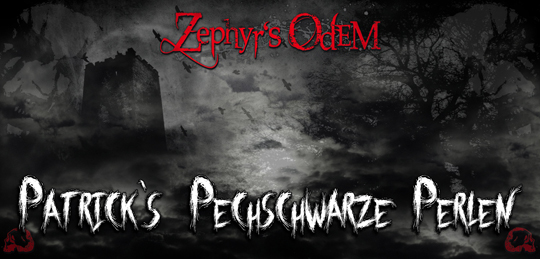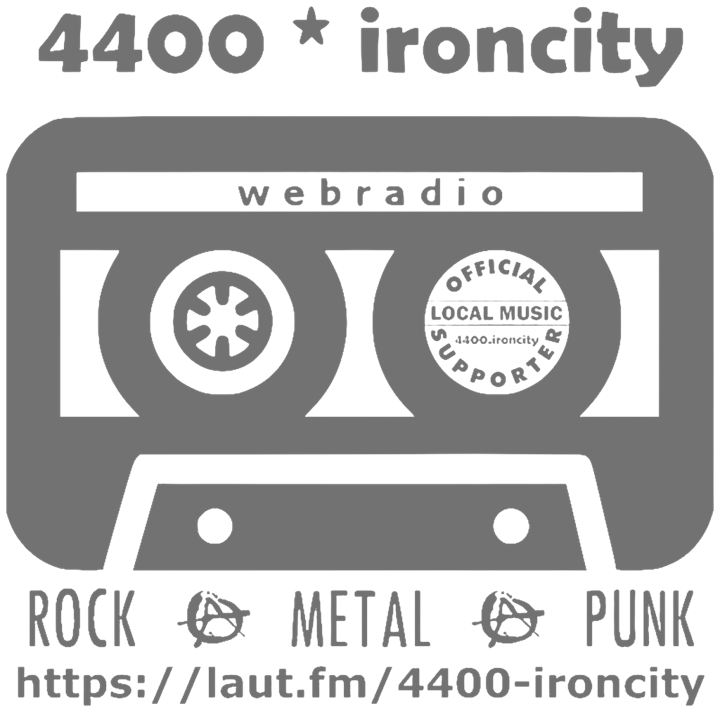Aktuelle Meldungen
Live on Stage Report: SKINDRED | ALIEN ANT FARM | SICKRET
22.11.2025 – Berlin @ Huxley’s

Manchmal sind es die kleinen Sätze im Alltag, die den Lauf der Dinge verändern. Am Freitag stand ich noch mit meinem Sohn Sören im Olympiastadion, Hertha BSC hatte sensationell den fünften Sieg in Folge geholt (seit 2001 nicht mehr passiert, und in Berlin sprechen wir gern von Wundern, wenn Fußball mal funktioniert). Die Stimmung war ausgelassen, und plötzlich sagte er: „Papa… morgen Skindred… ich will mit.“ Bäm. Familienausflug deluxe.
Schon die Schlange vor dem Eingang ließ erahnen, dass hier heute niemand mehr umfallen können würde. Dank unserer Akkreditierungen waren wir allerdings schnell drin und sicherten uns die besten Plätze des Hauses: ganz oben auf der Balustrade, direkt hinter dem FOH. Beste Sicht, perfekter Klang – und die Möglichkeit, den Technikern beim Verzweifeln zuzusehen. Getränke geholt, Sören stand erwartungsvoll neben mir, und das Licht ging aus. Showtime.
Die ersten, die den Rummel eröffneten, waren die Schweizer Sickret aus Luzern. Seit 2010 mischen sie Nu Metal, Hardcore und Groove zu einem Sound, der hörbar von Limp Bizkit, early Korn und ein wenig Hatebreed-Kante inspiriert ist. Klingt auf dem Papier energisch – live aber leider etwas verwaschen.
Der Sound war matschig, wirklich matschig. So, als hätte jemand einen Eimer Leim in die PA gekippt. Egal ob schnelle Parts, Shouts oder Groove-Momente – es verschwamm alles. Sören schaute mich irgendwann an und fragte halb im Spaß: „Das ist immer noch der erste Song, oder?“ Ich konnte nicht mal guten Gewissens widersprechen. Genau die gleiche Frage hatte ich mir beim Wiedereintritt gestellt, nachdem ich draußen kurz frische Luft geschnappt hatte.
Trotzdem: die Halle füllte sich rasant, und die Band steckte viel Energie rein, um die Stimmung hochzuziehen. Als Warm-up funktionierten sie. Nicht spektakulär, nicht bleibend – aber sie brachten die Leute in Bewegung. Und das ist mehr, als manch andere Opener schaffen.
Ich gebe zu: Auf Alien Ant Farm war ich wirklich gespannt. Die Band begleitet mich seit Anfang der 2000er – und auch wenn sie nie die kommerziellste war, haben sie ein paar wirklich starke Alternative-Rock-Perlen geschrieben. Dass meine Frau ihren „College-Alternative-mit-Komplexität“-Sound nicht sonderlich schätzt, ist bekannt – aber daran scheitert ja kein Abend.

Die Band erschien mit zwei Sängern, was live direkt positiv auffiel: mehr Variabilität, mehr Dynamik, mehr Spielfreude. Songs wie Courage, These Days, Movies oder die neueren Storms Over und Last dAntz kamen gut, aber…
…auch hier schlug das Matschsound-Phänomen erneut zu. Ich weiß nicht, was das FOH da tat, aber vermutlich war es ein Kampf mit einer Akustik, die spontan beschlossen hatte, in den Streik zu treten. Trotzdem: „These Days“ ging ins Bein, „Movies“ ins Herz – und als Abschluss durfte natürlich Smooth Criminal nicht fehlen. Der Moment, in dem 1.500 Leute plötzlich anfangen, kollektiv Michael Jackson zu kanalisieren, ist einfach immer wieder absurd schön. Das Publikum tobte, und der Hit, der den AAF-Ruhm begründete, rettete ein etwas schwankendes, aber sympathisches Set. Ein guter Anheizer. Kein großartiger – aber solide und absolut unterhaltsam.
Dann wurde es dunkel. Die Lichtanlage arbeitete sich warm, als müsse sie selbst erst einmal tief Luft holen, bevor gleich etwas Überwältigendes passieren würde. Und dann ertönte Thunderstruck aus den Boxen – nicht irgendeine Konzertmusik, sondern das akustische Startsignal dafür, dass jetzt niemand mehr sicher war. Erst als der speziell für die Band zugeschnittene Remix des Imperial March einsetzte, zündete der Moment endgültig. Benji Webb und seine Mannen betraten die Bühne, und der Jubel, der daraufhin losbrach, dürfte locker bis zur Hasenheide geschwappt sein.
Mit Set Fazers eröffnete die Band das Set und katapultierte das Energielevel direkt so hoch, wie andere Gruppen erst nach anderthalb Stunden maximaler Anstrengung erreichen. Ich konnte von unserem Platz hinter dem FOH aus genau sehen, wie alle Anzeigen der zulässigen Dezibel am Mischpult aufleuchteten – durchgehend rot, durchgehend am Limit. Skindred bleiben nie unter Grenzwert. Das ist ihr Normalzustand.

Drummer Arya Goggin prügelte mit beeindruckender Präzision und Wucht auf sein Kit ein, und auf der Bassdrum prangte das Konterfei von Roger Moore. Ein James-Bond-Motiv mitten in einem Skindred-Konzert – herrlich absurd und perfekt passend, besonders wenn man weiß, dass später Nobody Does It Better als Outro folgen sollte. Genau solche Details machen diese Band so charmant.
Benji Webb selbst war wie eine Naturgewalt. Er war ständig in Bewegung, rannte, tanzte, drehte Kreise, posierte zwischendurch wie ein hyperaktives Karate-Meerschweinchen auf glitzernder Überholspur und wechselte seine Outfits so häufig, dass man irgendwann den Überblick verlor. Dazu die enorme Publikumsinteraktion, dieser Predigerblick, dieses „Ich weiß genau, dass ihr mich feiert“ – und das Publikum tat genau das.
Die Setlist war eine einzige Achterbahnfahrt, bei der man sich immer wieder anstellen will: Stand for Something ließ sofort sämtliche Fäuste in die Luft schnellen, Rat Race brachte mit dem kurzen Oasis-Zwischenspiel ein kollektives Grinsen ins Publikum, und Pressure löste eine Hüpforgie aus, bei der das Huxley’s vibrierte wie ein Presslufthammer. Trouble und That’s My Jam brachen jede tänzerische Zurückhaltung, während das völlig verrückte Medley aus Master of Puppets, Last Resort und Jump einer dieser Momente war, die man niemandem erklären kann, der nicht dabei war. You Got This, die neue Single, fügte sich ein, als hätte sie schon immer dazugehört, und Kill the Power sowie Big Tings machten endgültig klar, dass heute nichts, absolut nichts auf Sparflamme laufen würde. Spätestens bei Nobody war die Halle ein einziger, brüllender, glücklicher Organismus, und als Gimme That Boom folgte, gab es ohnehin kein Halten mehr.
Und dann kam Warning. Natürlich. Und natürlich stand plötzlich Dryden Mitchell, der Sänger von Alien Ant Farm, mit auf der Bühne, während die Menge kollektiv den Newport Helikopter startete. Es war ein einziges Gewirr aus T-Shirts, Schweiß, Geschrei und Ekstase.

Der Abend endete schließlich nicht mit einem letzten Live-Song, sondern mit einer liebevollen, fast schon ikonischen Geste aus den Boxen: Nobody Does It Better in der Originalversion von Carly Simon. Während der Song lief, blieb die Band noch auf der Bühne, nahm den Applaus entgegen, verbeugte sich, zeigte aufs Publikum, herzte sich gegenseitig – ein stiller, aber intensiver Triumphmoment, in dem die gesamte Halle die Vier noch einmal ausgiebig feierte. Ein Kontrast zu der zuvor tobenden Energie, aber genau deshalb wirkte es so stark.
Ich habe Skindred inzwischen rund fünfundzwanzigmal live gesehen, und dieser Abend spielte ohne Frage in der obersten Liga mit. Die Energie war unfassbar, die Setlist perfekt ausbalanciert, die Halle bis auf den letzten Millimeter gefüllt, Benji in absoluter Höchstform, und das Publikum ging von der ersten bis zur letzten Sekunde mit, als gäbe es kein Morgen. Dazu der persönliche Aspekt dieses Familienabends, der besser nicht hätte laufen können.
Ein Triumphzug. Eine Party. Ein Feuersturm. Ein perfekter Abend.