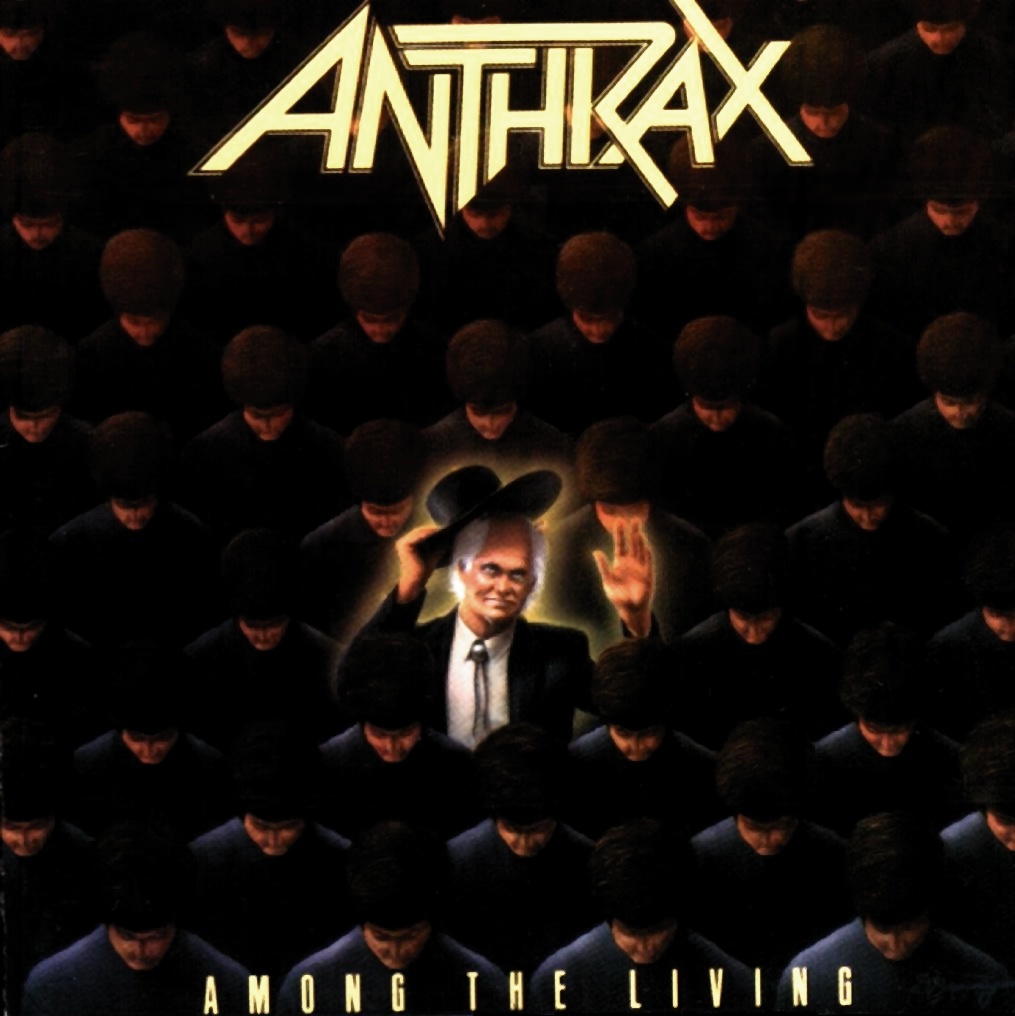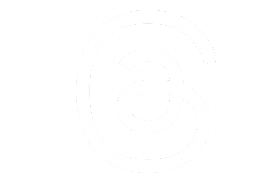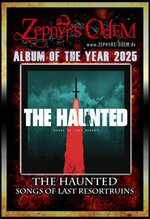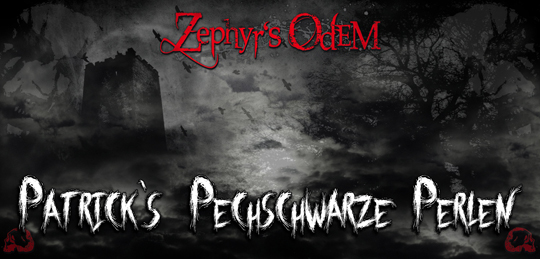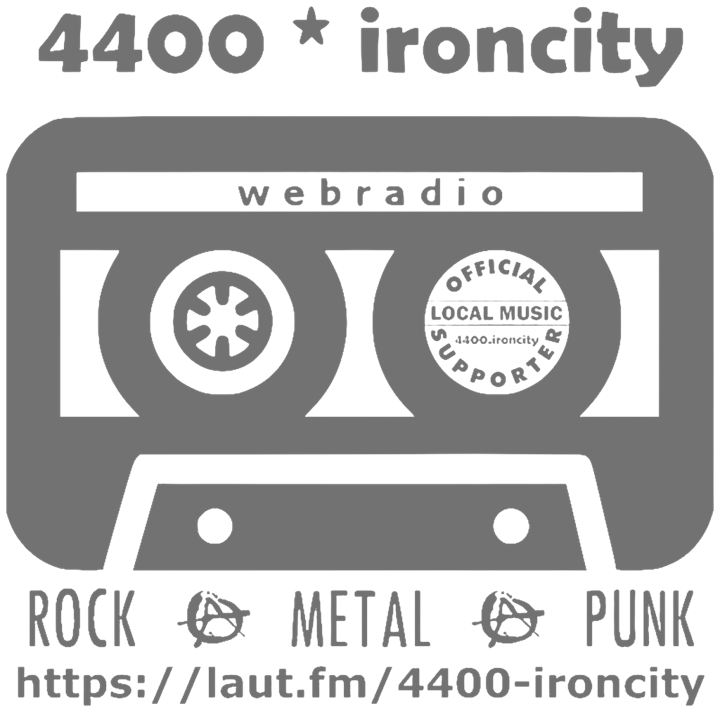Label: AFM Records
VÖ: 15.09.17
Stil: Alternative Metal
Ein Abend mit Soil…
Soil waren mir persönlich bislang noch unbekannt, weshalb es für mich weniger müßig erscheint, ein Best-of Album wie „Scream: The Essentials“ zu besprechen. Natürlich wird sich ein Fan aus frühesten Tagen fragen, ob nun unbedingt dieser oder jener Song auf dem Album hätte präsent sein müssen oder eher nicht. Ich für meinen unbedarften Teil gehe das Ganze mal locker an und genieße einen hoffentlich schönen Abend voller neuer Musik, während sich die Stadt im Chaos zwischen Fußballfans und Helene Fischer-Konzertesuchern befindet. Also Kopfhörer auf, Noise-Reduction rein und ab dafür …
Fast punkig-rotzig geht es mit dem neuen Track „Gimme some Lovin‘“ los. Das Ding ist so simpel, dass es beim ersten Hören sofort im Ohr bleibt. Und doch sind kleine Variationen in den Strophen und der Halftime am Ende fast unauffällige Gimmicks.
„Broken Wings“ präsentiert sich mit breiten Riffs. Der Aufbau zeigt den klassischen Aufbau eines „Alternative“ Songs Anfang der 2000er, soll heißen, dass die Strophen eher ruhiger und abgedämpft sind, während die Brücken und vor allem der Chorus alles geben. Die Vocals zeichnen sich als tragend aus, um welche der ganze Song aufgebaut ist. Die Drums treiben den Song mit zum Teil brachial gedroschenen Crash-Becken voran.
Volles Rohr voraus ist die Devise bei „Road to Ruin“. Triolisch hüpfend, wie es sich für einen zünftigen Untergang gehört, hopst der Song. Ich sehe den pogenden Mob bei einem live-Konzert vor Augen. Erneut fällt auf, dass die Stimme der Fokus des Songs ist, dass aber als neue Erkenntnis die feine Akkord-Zerlegung der Gitarre in Brücke/Chorus hängen bleibt.
„Black Betty“ kann man covern, muss man nicht. Soil präsentieren den Klassiker in ihrem Klanggewand und setzen die Breaks und die Soli auf den Punkt. Kein Ausfall, aber bestimmt nicht der Höhepunkt des Schaffens und dieser Platte.
Als diene „Black Betty“ als Zäsur, fängt mit „Halo“ eine etwas andere musikalische Ausrichtung an. Grooves und Struktur wird beibehalten, aber irgendwie knallt es mehr, was an einer anderen Aufnahmetechnik liegen mag oder an den tiefen Gitarren. Tiefes h knallt halt böse. Durch diese klangliche Änderung kommen die Vocals noch mehr zur Geltung, die zum Teil alles an Rotzen und Shouten verlangen. Die Texte und die Phrasierung werden zum rhythmischen Kontrapunkt zur stoisch durchgroovenden Band.
Das findet sich auch bei „Unreal“, wobei hier das Gaspedal trotzt allen Frusts nicht ganz so durch getreten wird. Der sehr ruhige C-Teil hält lässt den Vocals Raum, damit der Shout… „fuucked!!“ richtig zur Geltung kommt.
„Breaking me down“ ist eine Achterbahnfahrt mit reichlich Tempo. Die Vocals rotzen bei höchster Drehzahl, um mit dem treibenden Grundtempo mithalten zu können. Erneut zeigt sich, wie gut die tiefen Instrumente und die Stimme sich ergänzen.
In „Pride“ zeigt sich, dass die Variation der Vocals (hoch-rotzig, mittig-melodisch) eine neue Bandbreite eröffnet. Musikalisch tut sich nichts, aber durch die gesangliche Leistung ist das auch gar nicht nötig. Mal gegeneinander, mal miteinander, mal zweistimmig, mal „hey“; das bietet gerade bei dem doch eher eintönigen Mid-tempo des Songs die höchstmögliche Variation. Mit einem Wort: Kunstgriff.
„ReDeFine“ weist einen sehr schön melodischen Chorus auf. Die Strophen sind im leichten Stakkato gehalten, was auch den Gitarren Raum für verfremdende Elemente gibt. Der C-Teil wird durch Western-Gitarren getragen.
Bis hierhin stelle ich fest, dass die Songstruktur sich nicht groß ändert, dass aber die Ausführung der Songs im Detail den Unterschied und Unterhaltungswert ausmacht. Außerdem mag ich die Kehrverse, die durch catchige Vocals gleich ins Ohr gehen.
„Can you heal me“, aufgenommen in Dimebag Darrel’s Studio, zeigt, dass die Songs auch ohne viel Krach tragen. Das bestätigt mein Zwischenresümee.
Wayne Static von Static-X erscheint bei „Give it up“ als Gast. Gut, dass zwischen „ReDeFine“ und diesem Song ein Akustik-Stück liegt. Das Songwriting ist schablonenhaft, nur die Vocals stechen durch hohe Growls hervor.
„Let go“ spielt erneut mit dem Gegensatz zwischen Entspannung in den Strophen und Anspannung im Chorus. Beide sind gesanglich harmonisch gehalten, wobei im Chorus auffällt, dass die Vocals die Akkordzerlegung der Gitarren mehrstimmig nutzen, um einen breiten Vielklang zu erzeugen. Bei relativ gleichbleibenden Strukturen erkenne ich Detail eine Weiterentwicklung. Auch die kürze des Songs weist darauf hin, dass was hier in seiner Schnörkellosigkeit angeboten wird, als Aussage ausreicht. Nur Linkin Park waren da noch direkter, wie sie von (überflüssigen) Soli keinen Gebrauch machten.
„Like it is“ zeigt, dass die Vocals immer mehr Screams nutzen, um neben ruhigen und melodischen Elementen eine weitere Einsatzmöglichkeit zu haben. Die Gitarrensoli, wie sich schon in „Let go“ andeutete, werden schneller und virtuoser. Das Zusammenspiel der Band ist eiskalt auf den Punkt.
Mal etwas Abwechslung zum zuvor Gehörten bietet „The lesser Man“, das rockig, fast 80s-artig wirkt. Solide Vocals und Gitarren tragen den Song, der in seiner Eigenartigkeit (gerade im Halftime-Strophenteil) vor Selbstbewusstsein nur so strotzt.
„My Time“ klingt nicht so gut wie sein Vorgänger. Die Gitarren wirken steril, was vielleicht ein Zeichen für die Aufnahmezeit ist. Strukturell wie gehabt.
„Shine on“ rotzt höllisch in der Strophe, weist ansonsten aber die bewährte Struktur auf. Das muss ja nicht schlecht sein.
Die Frage beschleicht mich bis hierhin, ob die Platten alle so wenig Abwechslung bieten. Wenn das Soil ausmacht, bekommt der Fan auf jedem Album bestimmt, was er möchte. Grooves, exzellente Vocals, die das wenig innovative Songwriting durch große Flexibilität auffangen.
„The Hate Song“ zeigt weder im Aufbau noch in der Akkordwahl große Unterschiede zum bisherigen Material. Das Ding funktioniert aber genau deshalb. Naja, vielleicht auch, weil jemand ein Liebeslied schreibt, um seine Abscheu auszudrücken.
So… fast fertig. „Way gone“ befasst sich mit der Enttäuschung, die aufkommt, wenn sich die Einsicht offenbart, dass eine Beziehung nicht aufgeht: „… a heart unbroken hasn’t lived, hasn’t loved…“. Musikalisch wirkt der Song durch die Synkopierung fast disko-artig, was dem Songwriting aber eine erfrischende Variante gibt. Der Chorus ist in seinem Mid-Tempo und breiten langen Akkorden, wieder eine Wand.
„Halo live in London“ bietet Vergleichsmöglichkeiten zwischen der Studio-Version und den live-Qualitäten der Band. Na klar, shoutet das Publikum „my little halo“ mit, was mir rückmeldet, dass ich bei der Einschätzung des Materials für live-Auftritte nicht falsch liege. Ob da nun Ultra-Fans sind oder jemand wie ich, die Zeile kann man nach dem ersten Chorus sofort mitshouten.
„Rusty Cage“ ist eine Hommage an Chris Cornell. Supertief gestimmte Gitarren nehmen den alten Soundgarden Song genau da auf, wo er stehen geblieben ist. Eine Hymne für alle, die in ihrem Käfig gefangen sind und ausbrechen müssen. Der Song war mir bislang auch im Original nicht bekannt. Danke für die Weiterbildungsmaßnahme…
Was bleibt zu resümieren nach etwas mehr als 68 Minuten Spielzeit (und weitaus mehr Recherchezeit; aber das ist ja das Schöne daran!)?
Soil gehören musikalisch deutlich den 2000ern an. Um in diese oder die nächste Dekade als innovative Band überzusetzen, bedarf es mehr als der beschriebenen Details, die sie von ihresgleichen zur Vergleichszeit unterscheiden. Ich für meinen Teil habe diesen Abend mit einem „Best-of Album“ einer für mich bislang unbekannten Band bei den erwähnten Abzügen durchaus genossen. Möge also der Fan über die wahre Punktzahl entscheiden.
Bewertung: 8,5 von 10 Punkten
Tracklist:
01. Gimme some Lovin‘
02. Broken Wings (El Chupacabra Version)
03. Road to Ruin
04. Black Betty
05. Halo
06. Unreal
07. Breaking me down
08. Pride
09. ReDeFine
10. Can you heal me (Acoustic Version)
11. Give it up (feat. Wayne Static)
12. Let go
13. Like it is (Alternate Version)
14. The lesser Man
15. My Time (Kickstart Version)
16. Shine on
17. The Hate Song
18. Way gone
19. Halo live in London (Bonus Track)
20. Rusty Cage (Bonus Track)