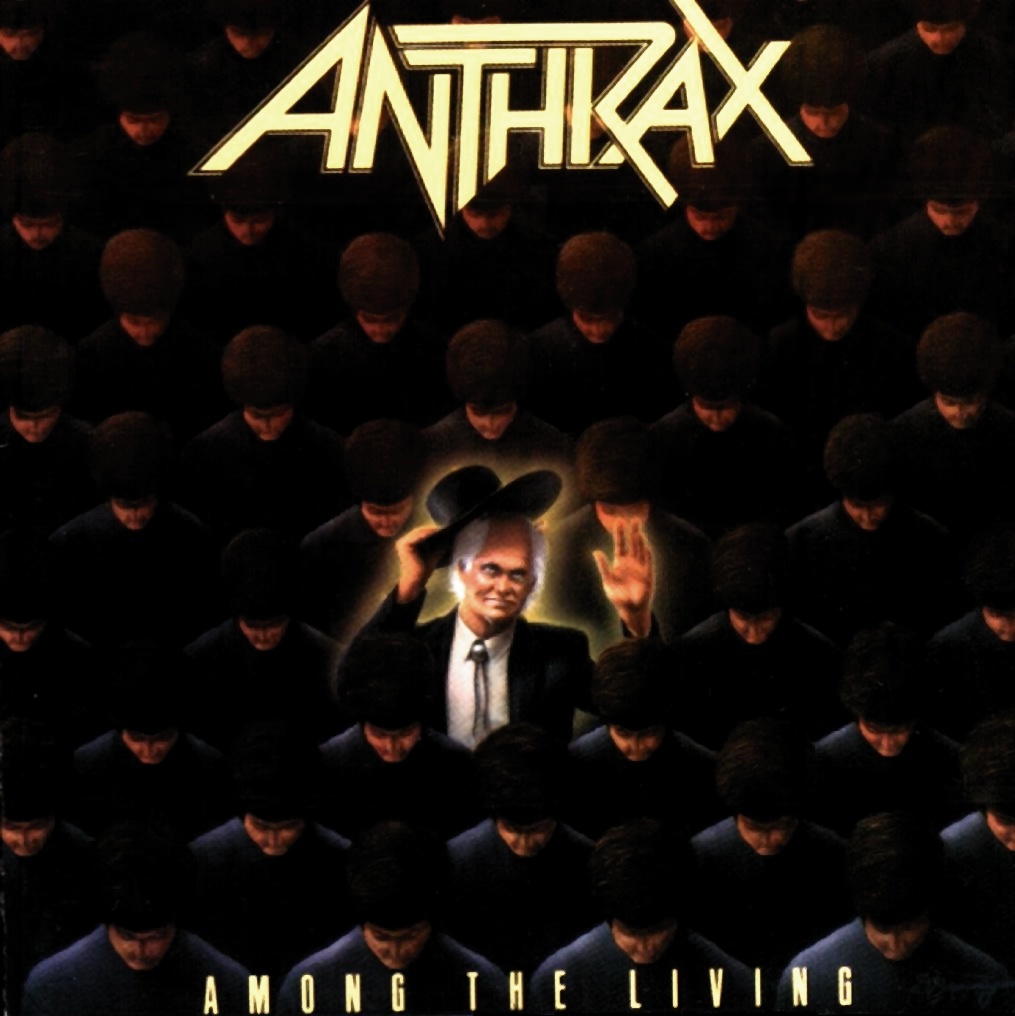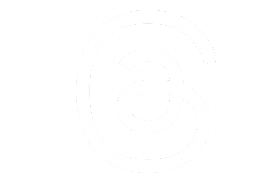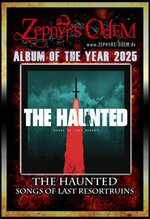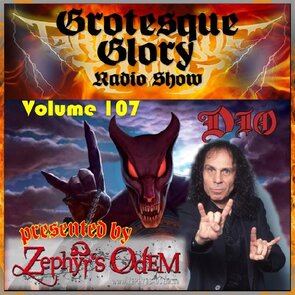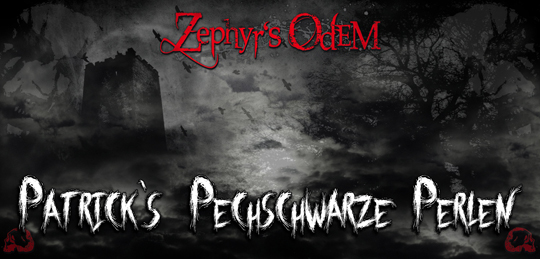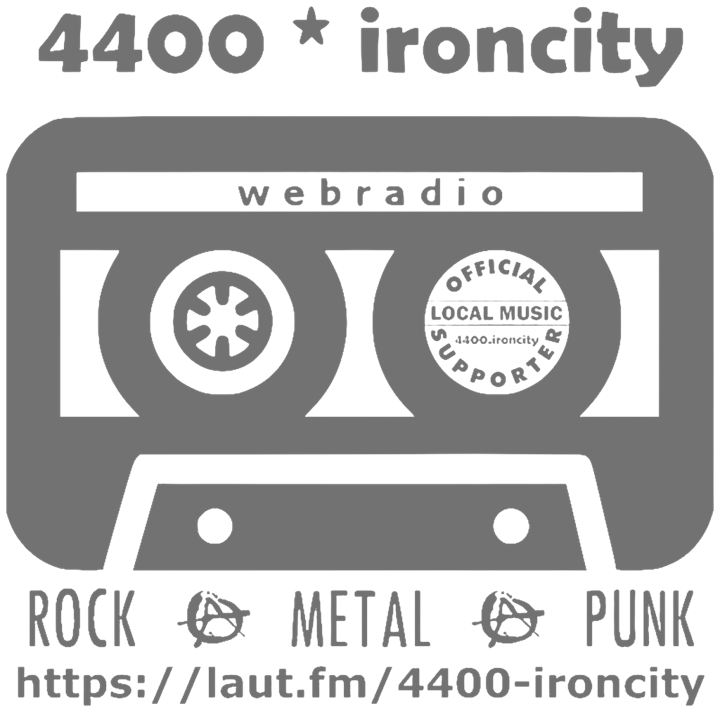Aktuelle Meldungen
Live-Report: Rock Harz 2025 TAG 3
Freitag, 04.07.2025 – Ein wenig Sand im Getriebe

Der dritte Tag des Rock Harz 2025 begann – wie so oft – mit einem paradoxen Erwachen: kaum vier Stunden Schlaf in den Knochen, aber der innere Festivalwecker klingelte unbarmherzig um halb sieben. Kein Wunder nach einem Gig-Marathon bis tief in die Nacht und anschließendem Campplausch mit Bier statt Beruhigungstee. Was macht man also zu dieser gottverlassenen Zeit, wenn selbst der Duschcontainer noch schnarcht? Richtig: Man zieht allein seine Kreise über das Gelände, atmet Staub, Morgensonne und Metalgeist ein – und genießt. Trotz 25.000 Besucherinnen und Besucher wirkt das Rock Harz wie ein verschrobenes Klassentreffen mit Bierflatrate: familiär, herzlich, irgendwie heimelig. Nur meine faulen Mitstreiter wollten nichts davon wissen, mit mir auf die Teufelsmauer zu stiefeln. Pfui! Wanderschuhverweigerer, alle!
Statt Gipfelkreuz also erstmal die berühmten drei K’s (ihr wisst schon…), ein bisschen Hirn lüften im Camp, reichlich Unfug verzapfen und über den sensationellen Vortag philosophieren. Zwischen King Diamond und Sodom hatten sich die Glieder gelockert und die Stimmbänder den Dienst quittiert – höchste Zeit also, neue Energie zu tanken. Zum Glück hatte ich am Vortag einen heiligen Gral unter den Festival-Fressständen entdeckt: den Mutzbraten! Und die Fressmeile neben dem Mutantenstadel war nicht nur kulinarisch ein Volltreffer – hier roch es nach echtem Handwerk, Rauch, Fett und Grillgut. Für Veganer und Vegetarier sicherlich ein Albtraum in 7 Gängen – für mich aber das fleischgewordene Paradies.
Gut gesättigt, leicht entglüht und mit einem Lächeln auf den Lippen ging es also zur Bühne, wo der Opener des dritten Tages schon wartete. Showtime!
SEASONS IN BLACK nutzten die Gunst des Schicksals – und des Kalenders: Am Veröffentlichungstag ihres neuen Albums Anthropocene, dem ersten Lebenszeichen nach zwölf Jahren Studioabstinenz, standen die Bajuwaren wieder auf der Bühne. Und siehe da: Der melodische Death Metal zündete sofort. Kein überproduzierter Firlefanz, sondern ehrlicher, bissiger Groove, der direkt in die Beine ging. Der etwas zerstreut wirkende Haufen vor der Bühne – offenbar noch im Halbschlafmodus – taute zusehends auf, es wurde gebangt, gegrinst und genickt. Dass man den sympathischen Trupp auch danach bei der Autogrammstunde belagerte, um Anthropocene direkt zu kaufen und signieren zu lassen, spricht für sich. Willkommen zurück, Jungs – das hat richtig Spaß gemacht!
Weniger Spaß, dafür mehr Staub, gab’s bei ARCTICS. Die finnischen Melodic-Rocker boten ein Spektakel irgendwo zwischen Seifenoper und Softrock-Festival, nur leider ohne Handlung oder Höhepunkt. Frontfrau Alva Sandström, namentlich wie gemacht für die trockene Harzluft, wirbelte ganz in Weiß (ohne Blumenstrauß) über die Bühne, als wollte sie gleich die Erlösung verkünden – oder zumindest einen Schlagerpreis gewinnen. Leider war das Ganze vor allem eins: keyboardlastiger Kitsch mit deutlich zu viel Playback und zu wenig Rock. Einziger Lichtblick: das mutige, wenn auch stilistisch völlig deplatzierte Bimbo-Cover von Lambretto, das zumindest kurzfristig Leben ins Publikum brachte. Mir war’s zu viel künstliche Süße – aber hey, irgendwer hat ja auch Raffaello erfunden.
DEFECTS aus Großbritannien machten mit ihrem 2024 veröffentlichten Debüt Modern Error schnell klar, wohin die Reise geht: moderner Metal zwischen Härte und Melodie, irgendwo im Kielwasser von Bury Tomorrow, Architects und Co. Jetzt standen sie also im Harz – und zwar nicht zum Wandern, sondern zum musikalischen Durchmarsch über staubige Festivalböden.
Die Energie der Band war zweifellos ansteckend. Frontmann Tony Maue brüllte und sang sich die Seele aus dem Leib, während die Gitarrenfraktion in bester Synchronpose durch Breakdowns und Melodiehooks pflügte. Besonders Tracks wie Scapegoat, Broken Bloodlines und das sehr hymnische End of Days wurden lautstark abgefeiert – nicht nur im Pit, sondern auch von den Leuten, die sonst eher zur gepflegten Mähne statt zum Core-Schlagkopf tendieren.
Ich persönlich fremdelte ein wenig. Der Sound war zweifellos professionell, der Auftritt dynamisch, aber dieses moderne Metalcore-Ding habe ich einfach schon tausendmal gehört – und oft spannender. Zwischen cleane Refrains, Djent-light-Riffing und Breakdown-Stakkato schlich sich bei mir eher Déjà-vu als Euphorie ein. Aber das ist Geschmackssache – und hier lag ich klar in der Minderheit, denn das Infield war gut gefüllt und feierte DEFECTS mit einer Begeisterung, als hätte man gerade die neuen Szenehelden entdeckt.
Alles in allem: Ein sauberer, energetischer Auftritt einer Band, die genau weiß, wie man Bühnen erobert. Ob sie dabei musikalisch neue Welten erschließen, bleibt offen – aber für den Moment hat es geknallt.


Ein bisschen Sand im Getriebe muss man einkalkulieren – gerade, wenn man seit Tagen auf einem Feld lebt, das mehr an eine Mischung aus Endzeitwüste und Mittelaltermarkt erinnert als an einen Festivalplatz. Und wenn dann auch noch das Line-up nicht durchgehend zündet, hilft selbst das beste Bier irgendwann nicht mehr.
HARPYIE zum Beispiel. Ich habe es wirklich mehrfach versucht. Aber wo andere Mittelalter-Fans textsicher in den Staub tanzten und Blut und Spiele oder Fauler Zauber feierten, da blieb mir nur die Flucht in Richtung Fressmeile. Diese Mischung aus Folk, NDH, Metal und Party-Kompatibilität ist für mich wie Fisch: Ich verstehe, warum Leute es mögen – aber ich bin raus. Dafür war das Infield ordentlich gefüllt, die Stimmung passte und die Band zeigte sich spielfreudig. Gönnt euch das – ich ging derweil erneut auf Mutz-Braten-Pirsch.
Bei AEPHANEMER wurde es dann schon eher mein Terrain. Die französische Melo-Death-Truppe um Frontfrau Marion Bascoul punktete mit einer technisch präzisen Performance, orchestralen Elementen und ordentlich Druck im Gebälk. Songs wie Path of the Wolf oder The Sovereign sind live durchaus eindrucksvoll, auch wenn der Funke nicht vollends übersprang. Vielleicht war ich auch einfach zu sehr im Wartemodus auf den nächsten Abriss. Handwerklich top, atmosphärisch solide – aber nicht ganz der Tritt in den Hintern, den ich mir erhofft hatte. Zum Glück sollte der aber nicht lange auf sich warten lassen …

DESERTED FEAR gehören inzwischen zu den wenigen Bands, bei denen man sich vor dem Auftritt eher fragt, wie geil es diesmal wird – und nicht, ob. Dass Kollege Hildebrand ausgerechnet beim Heimspiel der Thüringer wieder kein Deserted Bier dabeihatte, ist allerdings ein Skandal erster Güte. Sollte das etwa System haben? Muss ich bald mit einer Stellungnahme des Metal-Inlandsgeheimdienstes rechnen?
Abgesehen von dieser eklatanten Versorgungslücke gab es allerdings nichts zu meckern. Wirklich nichts. DESERTED FEAR sind längst über den Status „aufstrebend“ hinaus und agieren mittlerweile mit der Selbstverständlichkeit einer Band, die weiß, dass sie längst in ihrer eigenen Liga spielt – irgendwo zwischen den Death-Metal-Klassikern und der Moderne, aber ohne Anbiederung und mit verdammt viel eigener Identität.
Die Setlist war – wie schon beim Rock Hard Festival – ein formidabler Querschnitt der Bandgeschichte, von Kingdom of Worms bis zum aktuellen Veins of Fire. Und ja, The Truth als Opener ist einfach ein Statement, wie ein nasser Lappen ins Gesicht. Der Sound? Glasklar und dennoch druckvoll. Die Band? Spielfreude pur. Das Wetter? Deutlich gnädiger als in Gelsenkirchen – was man nicht nur an der besseren Laune auf der Bühne, sondern auch an der deutlich wachsenden Staubwolke im Pit ablesen konnte. Und wer jetzt sagt, Fußwippen sei keine körperliche Aktivität: Ich hatte Sand im Schuh und Nackenmuskelkater, also zählt das.
Besonders Blind, Funeral of the Earth und At the End of Our Reign zündeten dabei wie Napalm auf trockenem Wald, während bei Welcome to Reality selbst die letzten Zaungäste ihre Bierbecher rhythmisch mitführten. Das abschließende Veins of Fire ließ dann keinen Zweifel mehr: DESERTED FEAR liefern – immer. Und zwar so souverän, dass man glatt glauben könnte, sie hätten heimlich ein Patent auf energiegeladenen deutschen Death Metal angemeldet.
Der Gig war ein weiterer Beweis dafür, dass DESERTED FEAR zu Recht an der Spitze der deutschen Death-Metal-Szene stehen. Sound, Setlist, Stimmung – alles auf Anschlag. Jetzt fehlt nur noch dieses vermaledeite Bier. Aber das nächste Festival kommt bestimmt.


Der Polen-Express donnerte mit voller Wucht über Ballenstedt – und was für ein Höllenritt das war! VADER, Polens Death-Metal-Urgestein um Bandkopf Piotr "Peter" Wiwczarek, machten kurzen Prozess mit allem, was ihnen in den Weg kam – inklusive der letzten Staubreste, die sich bis dahin noch nicht in Lungen und Klamotten eingenistet hatten. Was dann folgte, war ein akustisches Panzergewitter, wie es nur wenige Bands nach 42 Jahren auf dem Buckel so souverän vom Stapel lassen können.
Dass VADER live eine Macht sind, ist kein Geheimnis. Aber dass sie sich in diesem Zustand präsentieren – mit messerscharfem Sound, maximaler Spielfreude und einem dermaßen agilen Auftritt – das ist schon fast frech. Pits kreisten wie die Mähdrescher in der Magdeburger Börde, während Wings, Xeper oder The Calling das Infield pulverisierten. Und ja, This Is the War fühlte sich exakt so an: als wäre man in einem Grabenkampf mit doppeltem Blastbeat-Einschlag.
Einziger Wermutstropfen: Kein einziger Song vom Jahrhundertalbum Tibi et Igni schaffte es in die Setlist – ein Verbrechen, das nur durch das fett bratende Lead Us!!! und das infernalisch abgefeierte Carnal ansatzweise kompensiert wurde. Dennoch: kein Grund zu meckern. Die Band agierte wie ein perfekt geöltes Kriegsgerät, ließ sich keine Schwäche anmerken und hatte sichtlich Spaß daran, Ballenstedt in Schutt und Asche zu legen.
Der Sound? Brillant. Die Fans? Rasteten aus. Das Fazit? Alles geil gewesen. Und als dann zum krönenden Abschluss der Imperial March aus Star Wars über das Gelände donnerte, war endgültig klar: Hier sind keine alten Männer am Werk, sondern Lords of the Blast, denen selbst Darth Vader den Helm ziehen würde.


Nach einem zwischenzeitlichen Totalausfall meiner körperlichen Systeme (die Sonne meinte es zu gut, mein Durchhaltevermögen weniger) musste ich schweren Herzens auf Draconian und Any Given Day verzichten. Hitze, Alter, Lebensweise – sucht’s euch aus. Der Schönheitsschlaf war jedenfalls dringend nötig. Doch kaum zurück im Infield, wurde ich mit einem Auftritt belohnt, der weder jugendfrei noch zivilisiert, aber dafür umso kultiger war: DIE KASSIERER!
Seit über vier Jahrzehnten ist das Wattenscheider Punk-Phänomen um Wolfgang „Wölfi“ Wendland eine Bastion des Anarcho-Humors und gepflegten Wahnsinns. Dass sie nach all der Zeit immer noch auf großen Festivals für kollektive Grenzüberschreitungen sorgen, ist bemerkenswert – und irgendwie auch beruhigend. Wie ein warmes Bier in der Hand: weißt du, was du kriegst, ist aber trotzdem geil.
Kaum hatten die ersten Takte eingesetzt, war klar: Hier wird’s nicht nur musikalisch nackt. Zweitsänger Christoph Halbe entledigte sich – wenig überraschend – seiner Kleidung in Rekordzeit, was selbst routinierte Kameraleute zur völligen Verzweiflung trieb. Objektive wurden schamhaft weggedreht, Handys sanken mit plötzlichem Akkuversagen zu Boden, und selbst die Vorstellung eines digitalen Zensurbalkens hätte wohl §184er-Albträume ausgelöst. Frei nach dem Motto: Die Kunst muss frei sein – auch untenrum.
Wölfi selbst zeigte sich gewohnt gelassen und las viele seiner Texte von einem Zettel ab. Was manche Sänger*innen ruinieren würde, sorgte hier nur für noch mehr Sympathiepunkte. Wer braucht schon Pathos, wenn es Blumenkohl am Pillemann gibt?
Und das Infield? Gänzlich aus dem Häuschen. Bei Mach die Titten frei, ich will wichsen sangen erstaunlich viele erstaunlich textsicher mit, bei Arsch abwischen rollten Tränen der Rührung oder des Lachens – schwer zu sagen –, und Wir wollen Bier wurde zur offiziellen Nationalhymne des Geländes erklärt. Die Krönung war eine Polonaise quer durchs Staubfeld, die sich irgendwo zwischen Karneval, Kindergarten und Irrenanstalt verorten ließ.
DIE KASSIERER sind ein Farbtupfer in der Metal-Masse – schrill, schräg, subversiv. Natürlich kann man sie schrecklich finden. Aber man kann auch einfach mitgrölen, sich eine Bratwurst gönnen und anerkennen, dass man selten so viele Menschen gleichzeitig hat grinsen sehen. Bildung gibt’s woanders – gute Laune hier.

Wenn man von einer OVERKILL-Show spricht, dann schwingen normalerweise Begriffe wie "Abriss", "Adrenalin" oder "New Jersey-Rotz mit Vollgas" mit – schließlich gehören Bobby „Blitz“ Ellsworth und D.D. Verni seit über vier Jahrzehnten zur Speerspitze des US-Thrash. Eine Band, die sich nie verbiegen ließ, nie weichgespült wurde und auch im Alter noch mehr Feuer als die meisten Jungspunde versprüht. Doch was passiert, wenn plötzlich eine Achse im gut geölten Thrash-Getriebe fehlt?
Die Antwort kam ohne Erklärung – Gitarrist Derek Tailer war nicht mit an Bord. Keine Ansage, kein Kommentar, einfach nur eine Gitarre weniger. Das Resultat: Ein hörbar ausgedünnter Sound, bei dem Dave Linsk sich redlich bemühte, die Lücken zu füllen, aber eben keine Wand aufbauen konnte. Klar, Songs wie Scorched oder The Surgeon leben ohnehin mehr von Tempo als von Bombast, aber gerade die Klassiker à la Elimination oder In Union We Stand benötigen dieses fette Brett aus dem Marshall-Turm, um wirklich zu explodieren. Stattdessen: halbgarer Zündfunke.
Dabei war die Setlist an sich eine kleine Reise durch die Epochen, angefangen beim aktuellen Material mit Scorched und The Surgeon, über frühe Kultklassiker wie Rotten to the Core und Hello From the Gutter, bis hin zur Mitsing-Granate Fuck You, die natürlich am Ende stehen musste. Auch Bring Me the Night und Deny the Cross wurden solide durchgeprügelt. Und ja, Bobby blitzte zwischendurch mit seinen typischen Fistelattacken und verrückten Grimassen, aber irgendwie schien auch er nicht voll auf dem Gaspedal zu stehen. Vielleicht war’s die ungewohnte Quartett-Konstellation, vielleicht eine interne Schieflage – vielleicht aber auch einfach nur ein Abend, an dem der Overkill-Zug nicht ganz aus der Werkstatt kam.
Versteht mich nicht falsch: OVERKILL haben hier keinen Totalausfall abgeliefert. Dafür sind sie zu professionell, zu routiniert und zu sehr mit ihrer eigenen DNA verwachsen. Aber im direkten Vergleich mit früheren Shows – sei es auf Clubtouren oder großen Festivals – fehlte hier einfach das gewisse Etwas. Kein Abriss, kein Inferno, sondern ein solider, aber überraschend gebremster Auftritt einer Band, die sonst für Vollkontakt-Thrash in Reinform steht.
Ein bisschen wie ein gut gekühltes Bier, bei dem jemand das CO₂ vergessen hat – erfrischend, aber nicht spritzig. Hoffen wir, dass es nur ein Ausrutscher war. Denn von OVERKILL erwarte ich eben mehr als "ganz okay".

Es gibt Bands, bei denen spalten sich die Meinungen wie das Universum in einem schlechten Sci-Fi-Film – und Gloryhammer gehören zweifellos dazu. Einst war ich selbst tief versunken in den glitzernden Galaxien rund um Angus McFife, ritt auf Einhörnern durch Space-Operetten und ließ mich willig in das absurde, aber charmante Konstrukt aus Bombast, Pathos und Power Metal entführen. Doch dann kam der Bruch. Thomas Winkler raus, Angus McSix solo, Gloryhammer mit neuem Sänger – und für mich: der Stecker gezogen. Was einst spaßiger Over-the-top-Klamauk war, verkommt seither zu einer weichgespülten Plastikversion seiner selbst. Und das liegt nicht nur am Frontmann-Wechsel, sondern auch daran, dass sich der Sound zunehmend in sich selbst dreht.
Wenn alle über Powerwolf oder die Warkings mosern, weil sie zu kitschig, zu inszeniert oder zu kalkuliert seien – Leute, habt ihr mal auf Gloryhammer geachtet? Das ist Kitsch auf Level 9000, mit einem Einhorn-Einhorn obendrauf. Aber gut, ich bin hier nicht der Maßstab. Denn während ich mir innerlich schon The Land of Unicorns zynisch mitsummte, tanzte das Infield kollektiv den galaktischen Hoots-Tanz. Tausende Arme, die bei He Has Returned zum Himmel deuteten, ekstatisches Gejohle bei Fly Away, und spätestens bei Wasteland Warrior Hoots Patrol war klar: Hier wird nicht gefragt, ob das albern ist, sondern wie sehr.
Der neue Frontmann Sozos Michael aus Zypern (Unicorn Invasion of Nikosia?) – muskulös, charmant, aber halt kein Winkler – mühte sich redlich, den Funken zu entzünden. Und tatsächlich, die Pyro knallte, das Bühnenbild glitzerte, und spätestens mit Gloryhammer als Song (und nicht als Bandname) war das Publikum restlos überzeugt. Ich hingegen fand’s vor allem... laut und klebrig.
Mit On a Quest for Aberdeen und dem geradezu kabarettistischen Keeper of the Celestial Flame of Abernethy wurde der Trash-Level so hochgeschraubt, dass selbst Godzilla in Tränen ausgebrochen wäre. Und ja, auch ich zuckte dann doch kurz mit dem Fuß bei Universe on Fire – ein Song, der trotz allem irgendwie zündet. Das Finale Hootsforce und der unvermeidliche Schlusspunkt The Unicorn Invasion of Dundee waren dann der Regenbogen-Zuckerguss auf dem ohnehin schon klebrigen Drachenpudding.
Wer Gloryhammer mag, bekam exakt das geliefert, was er oder sie sich erhofft hatte: galaktischen Bombast, kindgerechte Texte, überzogene Kostüme und eine Reitstunde auf dem Einhorn durch die Power-Metal-Galaxis. Ich hingegen fühlte mich wie ein verbitterter alter Jedi-Meister, der seinen einstigen Padawan ins kitschige Dunkel abrutschen sieht. Aber das ist okay. Nicht jeder Held braucht ein Schwert – manchmal reicht ein blinkender Plastik-Laser und ein Song wie Fly Away.


Wenn der Wind über das staubige Feld fegt und der Mond sich wie ein dämonisches Auge über Ballenstedt legt, dann weiß man: Cradle of Filth sind im Haus – oder besser gesagt, auf der Bühne. Und was die britischen Meister der theatralischen Dunkelromantik da ins Rock Harz katapultierten, war weit mehr als ein schnöder Gig. Es war ein audiovisueller Exorzismus im Gewand der Extraklasse – mit Feuer, Nebel, Falsett und einer alles verzehrenden Bühnenenergie. Das Motto? Ballenstedt zerstören! Und genau das geschah.
Natürlich sind Cradle of Filth nicht gerade für subtile Zurückhaltung bekannt. Zwischen viktorianischem Vampirgrusel, blackmetallischer Raserei und Gothic-Kitsch tanzen sie seit 1991 auf einem schmalen Grat, den kaum jemand sonst mit solch anhaltendem Erfolg beschreitet. Ob Dusk and Her Embrace, Midian oder jüngst Existence is Futile – Dani Filth und seine wechselnden Mitstreiter haben eine Nische geschaffen, die zwischen Genialität und Wahnsinn oszilliert. Und live? Da sind sie eine Naturgewalt.
Schon mit To Live Deliciously wurde unmissverständlich klar, dass heute keine halben Sachen gemacht werden. Der Sound? Brutal gut. Keine matschige Suppe, keine verwaschenen Gitarren – alles klar, direkt und präzise. Ein Soundteppich aus Rasierklingen. Und mittendrin Dani Filth, der sich in bestechender Form zeigte. Seine Schreie bohrten sich durch Mark, Bein und Zeltplane, während seine Bühnenpräsenz wie ein finsterer Hofnarr auf Speed wirkte. Klein an Statur, aber groß in Ausdruck – und das mit über 50 Lenzen. Respekt, mein Herr.
Die Setlist war ein feuchter Traum für alle, die der Band über Jahrzehnte treu geblieben sind: The Forest Whispers My Name rief wohlige Erinnerungen an die Frühwerke wach, Malignant Perfection nagelte einen direkt an die Wand der Gegenwart, und The Principle of Evil Made Flesh holte die Nostalgie-Dröhnung mit Schmackes zurück. Doch spätestens bei Her Ghost in the Fog war klar: Hier wurde nicht nur Musik gemacht, hier wurden Herzen entflammt und Hälse heiser geschrien.
Optisch? Ebenfalls ein Volltreffer. Die Outfits irgendwo zwischen viktorianischem Bordell und Höllenzirkus, Nebelmaschinen im Dauereinsatz und als Sahnehäubchen Gitarrist Ashok als waschechter Pinhead. Wer da nicht klatscht, ist entweder blind, taub oder neidisch. Und wenn dann noch Death Magick for Adepts die ohnehin glühende Bühne abfackelt, bleibt nichts außer Finsternis, Erschöpfung – und Euphorie.
Cradle of Filth zeigten sich an diesem Abend in einem perfekten Gesamtzustand – tight, spielfreudig, präsent. Keine Spur von Altersmüdigkeit, kein Anflug von Routine. Für mich: eines der Highlights des dritten Tages. Und wer nach diesem Auftritt noch glaubt, Cradle seien bloß eine Showband für Gothic-Romantiker, der hat den Sinn für infernalische Grandezza einfach nicht verdient.


Dark Rock? War für mich immer so etwas wie Räucherstäbchen im Musikformat – viel Nebel, viel Gefühl, wenig Biss. Dementsprechend skeptisch stand ich dem Auftritt der Hamburger Düsterrocker MONO INC. gegenüber. Doch was dann folgte, war mehr als nur ein Pflichtbesuch zwischen Bratwurst und Bierstand. Es war ein atmosphärisch dichtes, musikalisch überzeugendes Konzert – und: eine Überraschung des Wochenendes.
Bereits die Stimmung im Infield war bemerkenswert. Fast andächtig, fast wie in einem Theater. Kein Gegröle, kein Gedränge – stattdessen gespannte Aufmerksamkeit und eine kollektive Erwartungshaltung, als würde gleich der Vorhang zu Wagners Ring aufgehen. Und dann kamen sie: MONO INC., in düster-stilvollem Bühnenoutfit, mit klarer Mission und spürbarer Spielfreude.
Frontmann Martin Engler, ganz der charmante Zeremonienmeister, führte souverän durch das Set, aber der heimliche Star des Abends saß hinter dem Drumkit: Katha Mia. Die Drummerin ist nicht nur ein optisches Aushängeschild der Band, sondern vor allem ein musikalischer Fels in der Brandung. Präzise, kraftvoll, und mit einer sichtbaren Freude, die sich direkt auf das Publikum übertrug. Wenn sie die Sticks schwang, hatte das etwas Erhabenes – als hätte sich Dave Grohl mit einer Prise Siouxsie and the Banshees paaren lassen.
Songs wie Voices of Doom, Louder than Hell oder das grandios hymnische Children of the Dark wurden von der Menge dankbar aufgenommen, mitgesungen, mitgelebt. Und nein, das war nicht bloß das „Ich-sichere-mir-schon-mal-einen-guten-Platz-für-Powerwolf“-Publikum. Die Leute waren wegen MONO INC. da – und sie bekamen genau das, was sie wollten: Drama, Melodie und ein Soundgewand, das trotz aller Dunkelheit angenehm zugänglich blieb.
Dass bald ein neues Album erscheint, wurde ebenfalls angekündigt – und ja, ich werde reinhören. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil mich dieser Auftritt wirklich neugierig gemacht hat. Meine Frau ist derweil bereits bekehrt und trägt den Children of the Dark-Ohrwurm wie eine neue Glaubensbekenntnis-Melodie vor sich her.
MONO INC. haben mich wider Erwarten abgeholt – mit Atmosphäre, mit Songs, mit Herz. Besonders Katha Mia hat sich in mein Trommelfell getrommelt und in mein Gedächtnis gespielt. Vielleicht bleibe ich kein Fan. Aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Es reicht zu wissen, dass gute Musik manchmal da beginnt, wo die eigenen Vorurteile aufhören.
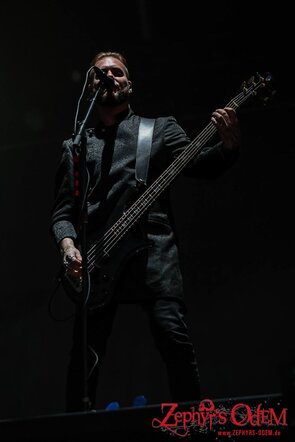
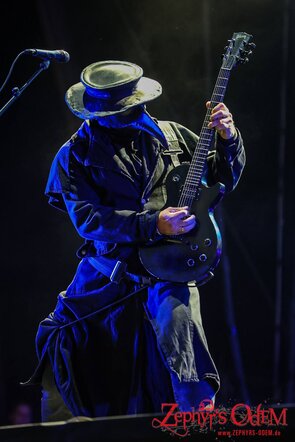
POWERWOLF – ein Name, der für einige die Offenbarung, für andere das Ende des ernstzunehmenden Heavy Metal bedeutet. Für mich? Eine Mischung aus beidem – und ein überaus unterhaltsamer Höhepunkt des diesjährigen Festivals. Wer hier Ernsthaftigkeit oder Authentizität sucht, sollte vielleicht lieber im Black-Metal-Zelt ein Tränchen verdrücken. Wer aber für ein bombastisches Spektakel mit eingängigen Hymnen, Pyrotechnik bis zur Unkenntlichkeit und einem aus dem Bauch gebellten „Vielen Dankeschön, meine lieben Freunde!“ zu haben ist, der kam hier voll auf seine Kosten.
Bereits am Nachmittag wurde klar, dass POWERWOLF den Begriff „Fankultur“ längst auf ein neues Level gehoben haben. Keine schnöde Autogrammstunde unterm Pavillondach – nein, es war Zeit für die lykanthropische Messe. Ein eigens herangekarrter Kran zog eine monumentale Glocke über das Gelände, läutete dreimal feierlich und verschwand wieder – vermutlich auf dem Weg zurück in die Kathedrale von Notre-Dame. Der Aufwand? Enorm. Der Andrang? Noch größer. Die Schlange der Jünger reichte fast bis nach Braunschweig, und dennoch bekam jeder sein Erinnerungsstück, ein Foto mit einem verschwitzten Bandmitglied oder wenigstens ein anerkennendes Kopfnicken. Wer sich bei dieser Gluthitze auch noch in ein Ganzkörper-Wolfskostüm gezwängt hatte, verdiente ohnehin den Metal-Orden erster Klasse in Platin.

Als dann der Vorhang fiel und Bless ’em With the Blade die liturgische Show eröffnete, war endgültig klar: Hier wird kein Konzert gespielt – hier wird zelebriert. Army of the Night, Amen & Attack und Dancing With the Dead folgten im bombastischen Gleichschritt. Die Band agierte wie eine geölte Kirchenmaschine. Vor allem Frontpriester Attila Dorn bewies einmal mehr, dass man sich mit genug Pathos, Humor und Stimmgewalt zum Halbgott in Schwarz hochsingen kann.
Die Setlist war ein Best-of aus Kirchenschauermärchen, Werwolfmessen und Heavy-Metal-Hymnen: Armata Strigoi, Demons Are a Girl's Best Friend, Fire and Forgive – es fehlte an nichts. Und auch wenn Heretic Hunters noch recht frisch im Repertoire ist, wurde der Song von der Gemeinde bereits mit Inbrunst mitgegrölt. Bei Stossgebet reckten sich dann selbst Hände gen Himmel, die sonst eher beim Black Metal verschränkt vor der Brust bleiben. Und spätestens als We Drink Your Blood das Feld in ein Fahnenmeer verwandelte, war klar: das war Headliner-Stoff.
Feuerfontänen, ein Bühnenbild irgendwo zwischen Vatikan, Hammer Studios und Vergnügungspark, und ein echtes Feuerwerk am Himmel – POWERWOLF machen keine halben Sachen. Wer sich fragte, warum das Infield trotz Headliner nicht bis zur Unkenntlichkeit überfüllt war, bekam eine einfache Antwort: Viele waren einfach zu platt, um sich in die erste Reihe zu kämpfen. Wer jedoch dabei war, hatte einen hervorragenden Platz und freie Sicht auf das audiovisuelle Donnerwetter.

Sicher, man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen. Aber wer behauptet, dass Metal keinen Spaß machen darf, hat das Konzept nicht verstanden. Die Band war bestens gelaunt, das Publikum hörig und laut – und der ganze Auftritt ein mit Weihrauch benebeltes Theaterstück, das in Erinnerung bleibt. Die ewigen Kritiker mögen sich mit Weihwasser duschen – ich hatte Spaß. Und zwar verdammt viel.
Wer in POWERWOLF nur den Disneymetal des deutschen Schwermetalls sieht, verpasst ein bombastisches Liveerlebnis mit großem Augenzwinkern, noch größerem Aufwand und hymnischem Bombast. Dass man damit heute Headlinerstatus erreicht, ist weniger ein Wunder als das Ergebnis jahrelanger, clever inszenierter Aufbauarbeit – samt Messe, Glocken und singenden Wölfen. Ob verdient? Aber sicher doch.

Es wurde still. Keine Crowdsurfer mehr. Kein Gegröle. Kein Pogo. Stattdessen ein Infield, das plötzlich innehielt – kollektiv, fast ehrfürchtig. Denn jetzt war die Zeit für SOLSTAFIR gekommen. Eine meiner Herzensbands. Und bei aller Liebe zu Blastbeats, Growls und Gitarrenwänden: Hier ging es um etwas anderes. Um Atmosphäre. Um Gefühle. Um nordische Melancholie in Klang gegossen. Kein Kitsch, keine Attitüde. Nur Musik, nur Gänsehaut. Und eine tiefe, bittere Schönheit, wie man sie sonst nur in den Weiten Islands findet – zwischen Nebel, Fjorden und seelischer Leere.
SOLSTAFIR ist keine Band. SOLSTAFIR ist ein Zustand. Eine Naturgewalt. Ein Polarlicht aus Klang. Wer das nicht fühlt, hat wahrscheinlich das Herz eines Tresors.
Schon der Opener Sálumessa legte sich wie Nebel über das staubige Gelände. Düster, sakral, unheilvoll – der perfekte Auftakt für diese isländische Zeremonie. Ohne große Begrüßung ging es direkt weiter mit Náttmál und Ghosts of Light, deren dynamische Spannungsbögen irgendwo zwischen Post-Metal, Psychedelic Rock und einer Prise Doom irrlichterten. Ich habe die Band schon oft gesehen – in kleinen Clubs, auf großen Bühnen, sogar in der Berliner Passionskirche, wo einst das Licht durch Buntglas auf die Bühne fiel wie göttliche Gnade – aber so brachial, so klar, so raumgreifend klang SOLSTAFIR noch nie.
Und dann kam Fjara. Der Song, bei dem selbst gestandene Wikinger weinen. Und ja, auch ich. Ein Tränchen? Zwei? Vielleicht auch drei – doch wer zählt das schon, wenn einem das Herz aufgeht und gleichzeitig zerbricht?

Erst nach diesem Gänsehaut-Moment folgte die erste Ansage. Und was für eine. Aðalbjörn Tryggvason, sonst eher wortkarg, schaltete plötzlich in den Plaudermodus, sprach über das Festival, das Wetter, über Dankbarkeit und darüber, dass es "eigentlich viel zu warm für unsere Musik" sei. Ein isländischer Schmäh, wie man ihn selten hört – charmant, lakonisch, auf den Punkt.
Mit Ótta kehrte die kontemplative Stimmung zurück – dieser hypnotische Rhythmus, der sich langsam aufbaut, sich ins Hirn gräbt und die Seele streichelt, um dann alles in bittersüßer Hoffnungslosigkeit zu ertränken. Und als ob das nicht genug wäre, folgte zum krönenden Abschluss noch Goddess of the Ages, in epischer Länge und voller Pathos, wie ein Gletscher, der sich in Zeitlupe ins Tal schiebt und dabei alles unter sich begräbt.
Nach dem legendären Konzert in der Passionskirche war das hier für mich der stärkste Auftritt von SOLSTAFIR, den ich je erlebt habe. Und ich wage zu behaupten: ein Jahrhundertgig. Danke an die Isländer für diese emotionale Grenzerfahrung – und danke an Dominik, dessen Fotos diesen Moment für die Ewigkeit festhielten. Sie zeigen, was Worte nur schwer beschreiben können: eine Band, die keine ist. Sondern ein Erlebnis.



Was für ein Tag. Was für ein Staub. Was für ein Finale! Der dritte Rock-Harz-Tag 2025 war ein Wechselbad der Gefühle, irgendwo zwischen Durststrecke und Hochgenuss – mit einer ordentlichen Portion Sand im Getriebe und noch mehr davon in den Lungenflügeln. Manch Band konnte die aufgestaute Hitze und das zähe Infield nicht komplett durchbrechen, doch Geduld wurde diesmal tatsächlich belohnt: Die großen Momente kamen spät, aber gewaltig.
Denn dann ging es Schlag auf Schlag: Sólstafir entführten in melancholische Sphären, verwandelten das staubige Feld in eine nordische Traumwelt, in der plötzlich alles ruhiger wurde – außen wie innen. Vorher zogen Powerwolf alle Register der bombastischen Messliturgie und rissen das Publikum trotz sengender Hitze mit hymnischer Inbrunst und einem sakralen Glockenkran in ihre Welt. Und Cradle of Filth brachten das Böse – auf einem Niveau, das man den Briten so manch andererorts nicht mehr zugetraut hätte. Was für ein Abend. Was für ein Endspurt.
Doch der Körper sprach irgendwann Klartext. Völlig im Eimer kroch ich zurück zum Zelt – ohne Promille, ohne Restenergie, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Denn bei diesem Wetter macht Saufen keinen Sinn, auch wenn der Schultheiß-Gelüste-Vulkan leise brodelte. Stattdessen schloss ich selig die Augen, mit Fjara auf den Lippen und Isländerträumen im Kopf – und schlief ein, während über mir noch der Staub des Tages durch die Luft tanzte.
OLAF
Fotos by DÖ (Dominik Müller)